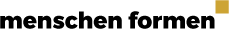0. Zuvor
Die vorliegende Arbeit folgt entlang einer Auseinandersetzung mit dem Begriff des Werdens bei Gilles Deleuze und Félix Guattari. Die zugrundegelegte Frage lautet: Wie ist das Werden zu verstehen? Und zudem: Wie läßt sich das Werden denken, wenn es in einer Form gefasst ist, die jegliche Vereinbarung zerstört, die auf einem ›Ich denke‹, auf unterschiedenen Termen ruhte? Deleuze und Guattari fassen das Werden rhizomatisch, als einen Block, in dem und mit dem etwas passiert. Um dieses Geschehen aufzeigen zu können, werden in der Arbeit ausgehend vom Rhizom und einer ersten Bestimmung des Werdens die wesentlichen Dimensionen des Werdens aufgegriffen: die Zone des ›Zwischen‹ in ihrer Verbindung mit einem ›Außen‹, die Diesheiten, die singulären Ereignisse und Mannigfaltigkeiten.
Anhand der Studie von Deleuze zu Francis Bacon werden die Merkmale und Elemente seiner Malerei geschildert und ihr Zusammenhang zum Thema des Werdens aufgezeigt. Mit dem Thema der Kunst werden dann die Empfindung und das Vermögen, die Dimensionen des Werdens zu denken, in die Überlegungen einbezogen. Die Bewegungen und Kräfte, die in einem Werden statthaben, werden im Zuge der Hinführung auf ein Tier-Werden erarbeitet, das notwendigerweise ein zweites, anderes Werden mit sich führt. Diese Fassung eines gleichzeitigen Werdens wird daraufhin zu entfalten und, anknüpfend an das Wahrnehmen der Kräfte und Bewegungen, zu verbinden versucht mit der Frage, wie diese Fassung gedacht werden kann, und was im Denken des Werdens geschieht.
Die einzelnen Abschnitte der Arbeit folgen in ihrer Beschaffenheit und in einer Linie, die aus den Schwierigkeiten folgt, das Werden zu denken.
1. Rhizom und Werden»Ein Werden ist immer in der Mitte, man kann es nur in der Mitte erfassen. Ein Werden ist weder eins noch zwei, noch die Beziehung zwischen beiden, sondern es ist dazwischen, die Grenze oder Fluchtlinie, die Fallinie, die vertikal zu beiden verläuft. Das Werden ist ein Block (Linien-Block), weil es eine Zone der Nachbarschaft und Ununterscheidbarkeit bildet, ein Niemandsland, eine nicht lokalisierbare Beziehung […].«
[1]So schreiben Gilles Deleuze und Félix Guattari in ihrem Buch ›Tausend Plateaus‹ – im zehnten Kapitel über das ›Intensiv-Werden, Tier-Werden, Unwahrnehmbar-Werden…‹. Das Werden ist eine »Mannigfaltigkeit«, die nicht durch ihre Elemente oder durch eine Einheit, sondern durch die Zahl ihrer Dimensionen definiert ist, von denen sie keine verliert oder gewinnt, »ohne ihr Wesen zu ändern«.
[2] Welches sind diese untrennbaren Dimensionen in einem Block des Werdens – was heißt Werden für die hier anzustellenden Überlegungen? Der Weg wäre, die Linien des Werdens aufzusuchen, von denen Deleuze sagt, sie haben weder Anfang noch Ende.
[3] Das Werden ist ohne Ausgangspunkt und ohne Endzustand, wonach es sich vielmehr, quer zu diesen, bestimmen ließe, wären folgende entscheidenden Markierungen: Das Werden ist dazwischen und es ist ein Block. Es ist rhizomatisch.
Das Rhizom ist ein Gefüge (agencement), es besteht aus Mannigfaltigkeiten. Wie das Werden gibt es in ihm eine Mitte und weder Anfang noch Ende, gibt es keine Positionen, sondern Linien. Es sind nicht mehr Punkte, sondern die Beschaffenheit des Rhizoms ist: jeden Punkt mit einem »beliebigen anderen Punkt« durch diverse Linien verbinden zu können, »wobei nicht unbedingt jede seiner Linien auf andere, gleichartige Linien verweist«.
[4] Das Rhizom besteht insofern nicht mehr aus Einheiten (als Subjekt und Objekt, oder als Punkte etc.), sondern aus einer bestimmten Anzahl Dimensionen. Von n Dimensionen, wie Deleuze/Guattari sagen, muß man das Eine immer abziehen, n-1 Dimensionen erstellen, um zum Gefüge, zum Mannigfaltigen zu gelangen. Das Rhizom bezieht sich nicht mehr auf das Eine, das dem Gefüge in einer zusätzlichen übergeordneten Dimension eine Einheit stiften würde, vielmehr ist diese abzuziehen (n-1), um ein Gefüge zu erhalten. In dieser Eigenheit kann das Rhizom »an jeder Stelle »unterbrochen oder zerrissen werden, es setzt sich an seinen eigenen oder an anderen Linien weiter fort«.
[5]Es sind Dimensionen des Gefüges, die »beweglichen Richtungen« und die wuchernden Linien, die eine Mannigfaltigkeit bestimmen und deren eine Bewegung ermöglichen: entlang einer Fluchtlinie sich mit anderen Mannigfaltigkeiten zu verbinden, dabei sich und »ihre Beschaffenheit zu verändern und sich völlig zu verwandeln«.
[6] Deleuze/Guattari wählen das Gefüge von Wespe und Orchidee, die ein Rhizom bilden: »Orchidee und Wespe bilden ein gutes Beispiel. Die Orchidee sieht aus wie ein Abbild der Wespe; […] Wird die Wespe Teil der Fortpflanzung der Orchidee, so die Orchidee nicht minder Geschlechtsorgan für die Wespe – ein und dasselbe Werden, ein einziger Block des Werdens«. Es ist ein »wirkliches Werden, Wespe-Werden der Orchidee, Orchidee-Werden der Wespe«, »ein zweiseitiges Einfangen also, da das, ›was‹ jedes der beiden Wesen wird, sich ebenso wandelt wie ›das‹, was wird«. »Das eine und das andere Werden verbinden sich miteinander und wechseln sich in einem Kreislauf von Intensitäten ab«. Das Werden ist nicht zu verstehen als eine Nachahmung oder Ähnlichkeit, es ist eine »Explosion zweier heterogener Serien auf der Fluchtlinie, die aus einem gemeinsamen Rhizom zusammengesetzt ist«, eine Bestimmung, die sich (die Ferne zu einem zweiwertigen Modell markierend) auch beschreiben läßt in einer Zusammenfügung: »nichts Wechselseitiges, sondern ein asymmetrischer Block, eine aparallele Entwicklung, Vermählung: stets ›außerhalb‹ und ›zwischen‹«. Und es ist darin beides zugleich, die Nähe oder eine Gemeinsamkeit des Zwischen und des Außen, die sich kaum ein- oder anordnen läßt außer in einer Abkehr vom Bezug der (zwei) Terme, zu denen das Werden ein Zwischen und Außen bildet. Es wird um beides und um diese Nachbarschaft gehen.
[7]Deleuze negiert für das Werden eine Entsprechung von Beziehungen, eine Ähnlichkeit, eine Imitation oder Identifikation. All das ist das Werden nicht, da es nicht aus Punkten oder feststehenden Termen, sondern aus Linien besteht, es geht nicht in einen angeblich feststehenden Endzustand über, zu oder von dem aus eine Relation gezogen und das als Objekt nachgeahmt oder gleichgesetzt werden könnte. Die Richtung, in die zu denken wäre – dazwischen und außerhalb –, zeigt sich mit der fliehenden, verändernden (alterierenden) Linie des Werdens an: »Das Werden kann und muß als ein Tier-Werden bestimmt werden, ohne einen Endzustand zu haben, der das gewordene Tier wäre«.
[8]
2. Ein ZwischenDer Literatur, der Musik oder der Malerei entnnommen werden in den Tausend Plateaus viele Arten des Tier-Werdens aufgeführt: Ratte-Werden, Hund-Werden, Pferd-Werden, Vogel-Werden u.a.m.
[9] Und in all diesen Formen des Werdens geht ein Mensch nicht dazu über, Tier zu sein. Weder spielt und imitiert er das Tier, noch ist es so, daß der Mensch »›wirklich‹ zum Tier wird«.
[10] Es ist ein wirkliches Werden, ohne das eine oder das andere zu sein, eher eine »widernatürliche Anteilnahme«, ein Block des Werdens, an dem der Mensch mit dem Tier zu tun hat, »Arten des Tier-Werdens, die den Menschen durchdringen und mitreißen und die ebenso das Tier wie den Menschen betreffen«.
[11] Ein einheitlicher Prozeß, von dem es heißt: »Das Werden ist ein Fang, ein Besitz«, der Mensch und Tier einfängt und von ihnen Besitz ergreift.
[12] Es sind die Tierverwandlungen Kafkas, denen Deleuze/Guattari ausführlich nachgehen. Diese Werden, denen eher das dazwischen entspricht, gehen in einem Gefüge vonstatten, das nicht durch Zusammensetzung/Beziehung trennbarer Elemente, sondern durch rhizomatische Mannigfaltigkeiten bestimmt ist. Deleuze/Guattari wollen das Werden als Involution verstanden wissen. Gegenüber einer Evolution, die von einem Sein in das andere überwechselt und niemals beides ist, verläuft ein Werden viel eher über ein »›Hinüberfließen‹«, (sich) windende Verwicklungen, sowohl Beteiligungen als auch Enthaltungen, die in ihrer Fügung zueinander die ihre Einheit ausmachenden Dimensionen verlieren.
[13] Dieses involutive Werden bildet einen Block, es geschieht in den Bewegungen des Blocks entlang seiner Linien, »›zwischen‹ vorhandenen Termen und unterhalb bestimmbarer Beziehungen«, die Mannigfaltigkeiten verändern sich an den Rändern, an (oder mit) den Fluchtlinien, Linien der Deterritorrialisierung, die sich von einem Menschen zum Tier, und vom Tier weiter erstrecken können.
[14] In den Tierverwandlungen bei Kafka wird das Tier oder das Tier-Werden als »die Möglichkeit eines Auswegs, einer Fluchtlinie« gedacht, einer Flucht, die den Formalisierungen zu entgehen trachtet – »Käfer werden, Hund werden, Affe werden, lieber Hals über Kopf abhauen, ›sich überkugelnd (…) hinaus und weg‹«.
[15]Es kommt (für dieses außerhalb) auf das dazwischen an, in dem das Werden selbst real ist, es geht nicht um die vorhandenen Terme, die feststehenden Punkte, diese sind vielmehr die Gefahren, denen das Tier-Werden ständig ausgesetzt ist: daß man das Tier doch nur spielt, imitiert und dabei nicht von einem Tier-Sein absehen kann.
[16] Das ist die Gefahr für das Werden, es mißzuverstehen und damit zugleich auch die Philosophie von Deleuze/Guattari, denn – darin sind sie dem kafkaschen Thema der Flucht verwandt – »die einzige Möglichkeit, aus den Dualismen herauszukommen, ist dazwischen sein, dazwischen hindurchgehen«.
[17] Die Aufmerksamkeit ist auf das zwischen zu richten, denn etwas geschieht »zwischen den Dingen, ein Zwischenstück, Intermezzo«. Worin besteht aber dieses Intermezzo? »Zwischen den Dingen bezeichnet keine lokalisierbare Beziehung, die von einem zum anderen geht und umgekehrt, sondern eine Pendelbewegung«, die zu einer anderen Bewegung gerät, eine quer zu den Termen verlaufende, eine »transversale Bewegung, die in die eine und in die andere Richtung geht«.
[18] Der Block des Werdens ist diese »Zickzackbewegung«. Doch mit der querstrebigen Richtung, die sich über Mensch und Tier hinaus erstreckt, gerät etwas anderes in die Aufmerksamkeit: das außerhalb, das diese Bewegung allein (oder alle Bewegung) nicht zu erfassen vermag.
[19] Was aber dann?
3. Der Block und die ZoneEin Zwischenraum, eine Kontiguität bildet das Werden.
[20] Es wird von Deleuze/Guattari eine bestimmte Unbestimmtheit erstellt, in der ein Werden geschieht, das dieses untrennbaren Blocks geradezu bedarf: »In der Linie oder im Block des Werdens, der die Wespe und Orchidee vereint, entsteht eine […] Koexistenz von zwei asymmetrischen Bewegungen, die auf einer Fluchtlinie einen Block bilden, […] Die Linie oder der Block schafft keine Verbindung zwischen Wespe und Orchidee, und ebensowenig vereint oder vermischt sie beide: sie geht zwischen den beiden hindurch und nimmt sie mit in eine gemeinsame Nachbarschaft, in der die Unterscheidbarkeit der Punkte verschwindet. […] Das Werden ist die Bewegung, durch die die Linie sich vom Punkt befreit und die Punkte ununterscheidbar macht: das Rhizom«.
[21] In einem solchen Gebilde (Gefüge) erfährt das Denken des Werdens eine neue Möglichkeit, wenn es nicht jene Bewegung von einer Einheit zur anderen Einheit ist, die die Wespe die Orchidee sein ließe (oder umgekehrt), sondern genau das ist, was sich ereignet – und zwar ereignet in einer Nachbarschaftszone, in der Wespe und Orchidee einen unauflösbaren Block bilden, indem beide mit diesem Block etwas erfahren: eine Veränderung, die sich quer zu ihnen ausrichtet. Im Treffen von Wespe und Orchidee, in dieser Zusammenfügung, fügen sich gleichsam die Komponenten ihrer Mannigfaltigkeiten in eine neu ausgerichtete Bewegung. Was hier für ein Denken eröffnet wird, betrifft sowohl etwas (als ein Ungedachtes), von dem wir wissen, daß es nicht die Wespe und die Orchidee ist (keine Einheiten), und gleichzeitig auch etwas, das mehr zu sein scheint als eine Mimesis, Abbildung etc. (aufgrund von Einheiten).
Das Werden ist nicht in Termen eines Subjektes (und Anfangspunktes) und eines für dieses als Endzustand dienlichen Objektes zu verstehen, da »sein Endzustand seinerseits nur in ein anderes Werden eingeschlossen ist, […] das mit dem ersten koexistiert und einen Block bildet«.
[22] Es ist, ohne Trennung oder Einteilung in (zwei) Einheiten, eine Anteilnahme. Wenn der Mensch mit dem Tier zu tun hat, in seinem Tier-Werden, so schreiben Deleuze/Guattari, werden ausgehend von den Formen, dem Subjekt und dem Objekt Partikel herausgelöst, »zwischen denen man Beziehungen von Bewegung und Ruhe, Schnelligkeit und Langsamkeit herstellt, die dem was man wird und wodurch man wird, am nächsten sind«.
[23] Eine Zone der Nachbarschaft oder der Kopräsenz, in die der Partikel gewordene Mensch gerät, eine »objektive Zone der Unbestimmtheit oder Ungewißheit, darauf, ›daß es gemeinsame oder ununterscheidbare Züge mit dem Tier gibt‹, eine Nachbarschaft, ›so daß es unmöglich ist, eine klare Grenze zwischen Tier und Mensch zu ziehen‹«.
[24] Tier werden kann man nur, wenn man Partikel herauslöst und aussendet, die mit den Partikeln oder in der Nachbarschaftszone des Tieres Verhältnisse von Bewegung oder Ruhe eingehen. D.h.: es geht nicht darum, etwas ›wie‹ ein Tier zu tun. Insbesondere dann nicht, wenn man das ›wie‹ als eine Metapher liest, mit deren Funktion »man nichts vom Werden verstanden« hat, wie Deleuze/Guattari betonen – setzt die Metapher doch auf die definierten Terme resp. ihre Bereiche: sonst gäbe es nichts zu übertragen. Das Tier-Werden ist eine Metamorphose und keine Metapher.
[25]Den bisherigen Überlegungen folgend hat sich das Werden als die Bildung eines unauflöslichen, asymmetrischen Blocks des Werdens gezeigt: Das Werden ist eine Doppelbewegung, es ist »immer zweifach, das, was man wird, wird ebenso wie der, der wird«. Es ist jedoch kein Austausch zwischen den Punkten oder Termen, es ist vielmehr ein untrennbares Sich-Ändern entlang einer Linie, die (nicht von einem Punkt zum anderen) zwischen den Punkten in eine andere Richtung geht (nicht Mittelmaß, sondern absolute Geschwindigkeit), wodurch sie eine Zone der Ununterscheidbarkeit bildet. In der Mitte anzufangen, »in der Mitte eine andere Richtung einzuschlagen« wäre eine Formel – die zudem etwas auftauchen läßt, den Gedanken, daß auch immer noch etwas anderes, zusätzliches geschieht, etwas das anders ist als das andere (und dabei doch keinen Superlativ, keine Steigerung der distanzierenden Zuschreibung ›das Andere‹ meint).
[26] Etwas, das sich – so der sich einschleichende Gedanke – allein in den zwei Termen (Wespe und Orchidee, Tier und Mensch etc.), doch noch nicht zeigt/zeigen läßt; und das selbst in einer auf diese Terme zurück- (oder vor-) greifenden Konstellation von Thematisierung und Auflösung dieser Paare nicht zureichend behandelt werden kann.
Nur als Block oder Ununterscheidbarkeit gibt es ein Werden: es nimmt seinen Ausgang mit Termen, die zuvor unterschieden sind.
[27] In der Nähe dieser Punkte, die ihrerseits eine Zone errichtet, die Nachbarschaft und eine Affizierung impliziert, ist das Werden Bewegung, oder die Gleichzeitigkeit zweier Bewegungen, die eine gemeinsame Änderung vollziehen, in der Bildung eines Blocks entlang einer Fluchtlinie, die sich zwischen den Termen durchzieht. Gleichgültig gegenüber der Frage, ob die Nachbarschaftszone aus den Zuständen der Terme resultiert oder umgekehrt, gibt es im Block eine Koexistenz von Bewegungen, die sich nicht wechselseitig bedingen, da für sie nicht mehr die (ob scheinbar oder nicht) unterscheidbaren Punkte maßgeblich sind, sondern die Linien, die einzig in der Mitte erfaßt sind (oder erfassen). Mit ihnen bildet sich ein Gefüge, ein Block aus Linien, der einer anderen Bewegung angehört. Im Sinne des völligen Abänderns ist anzunehmen, das etwas in die Bewegung hineinkommt, das anders als das Andere ist und sich in einem Tier-Werden nicht auf das Tier als das Andere des Menschen transferieren und reduzieren läßt. Es ist ein womöglich Kräfte zehrendes Alterieren, das diese Metamorphose ›des Anderen‹ geschehen läßt. In diesem Hinzutreten, in dieser Auflösung der Terme ist nach jenen Kräften zu suchen.
Anhand eines literarisches Textes um-schreiben Deleuze/Guattari diesen Prozeß: »ich habe Hunger, die ganze Zeit Hunger, ein Mensch darf nicht hungern, ich muß also zu einem Hund werden, bloß wie? […] Ich muß meinen Körperteilen Schnelligkeits- und Langsamkeitsbeziehungen geben, die den Körper in einem ursprünglichen Gefüge, das nicht mit Ähnlichkeit oder Analogie arbeitet, zum Hund werden lassen«. Es reicht also aus, Schuhe über die Hände, über ›alle viere‹ zu ziehen, wobei man schon (etwas mehr Hund) die ›Schnauze‹ benötigt. Der Mensch wird Hund…? »Die Frage: ›Was wirst du?‹ ist töricht. Denn in dem Maße, wie einer wird, ändert sich das, was er wird, genauso wie er selbst«.
[28] Er »kann nicht zum Hund werden, ohne daß der Hund zu etwas anderem wird«, beantworten Deleuze/Guattari die Frage. Es ist ein Hund-Werden des Menschen und – zudem, oder eher dabei – ein Werden des Hundes, ein anderes Werden, »das zum Teil des Gefüges« wird.
[29] Im Gefüge, im Tier-Werden des Menschen, geschieht etwas gleichzeitig, etwas währenddessen, »während das Tier zugleich zum… (ja, zu was wird? Wird es zum Menschen oder zu etwas anderem?)« – stellen Deleuze und Guattari die Frage.
[30] In der Tat gelingt das Tier-Werden, das Vogel-Werden nur in dem Maße, »in dem der Vogel dabei ist, etwas anderes zu werden, reine Linie und reine Farbe«.
[31]
4. In ein Werden hineinWas das Werden erfordert, ist ein Kraftaufwand. Ein weiteres Moment einer Analyse des Werdens, das sich gleichsam mit der (in einem Zusammentreffen) neu (ein)geschlagenen Richtung der Blocklinie ergeben hat und sich wie von den feststehenden Termen so auch von der Bewegung selbst ablöst/-hebt. Wie ließe sich dieser Moment fassen? In jedem Fall gibt es eine Anstrengung im Werden. Die Personen, die in einem Werden begriffen sind, sind gleichsam Athleten, es ist »eine Athletik des Werdens, die lediglich Kräfte offenbart, die nicht die ihren sind«.
[32] Diese äußeren Kräfte wären vergleichbar mit dem Außerhalb, das die Mannigfaltigkeiten definiert, es sind die Fluchtlinien, entlang deren Verlauf mit den Mannigfaltigkeiten eine Veränderung geschieht.
[33] Die Anstrengung, die in dieser völligen Verwandlung liegt, beruht auf »ganz besonderen Kräften des Außen«, mit denen die »Kräfte im Menschen in Beziehung treten«, etwa dahingehend, Komponenten und Partikel in Nähe zueinander zu bringen.
[34] Diese Kräfte im Werden hervorzuholen, die Anstrengung des Menschen oder des Vogels in Farbe überzugehen, es in Farbe übergehen zu lassen, sichtbar zu machen – führt im weiteren zur Kunst. Doch was zeigt sich mit den Kräften, welche Verbindung gehen diese mit dem Werden und der Bewegung ein? Was die Kräfte in das Tier-Werden überführt, auf den Menschen überträgt, ist ein Vermögen, das im Außen ruht, da die Realität des Tier-Werdens nicht »in dem Tier liegt, das man imitiert oder dem man ganz entspricht, sondern in ihnen [den Arten des Tier-Werden; A.L.] selber, in dem, was uns plötzlich ergreift und uns werden läßt, eine Nachbarschaft, eine Ununterscheidbarkeit, die aus dem Tier etwas gemeinsames herauslöst […]«.
[35]Was treibt in ein Werden hinein? Es kann »irgendetwas sein, etwas ganz Unerwartetes oder Unbedeutendes«, was Mensch und Tier erfaßt.
[36] Deleuze/Guattari führen einen Begriff an, der einen Modus der Individuation beschreibt, der »sich sehr stark von dem einer Person, eines Subjektes, eines Dinges oder einer Substanz unterscheidet«: die Haecceïtas, Diesheiten. Sie sind ein »regelrechtes Gefüge« oder Rhizom, definiert durch Linien oder ein Verhältnis von Ruhe, Bewegung und Geschwindigkeiten der Partikel, die für die Zone der Nachbarschaft bestimmend sind und eine weitere Eigenschaft des Vermögens bestimmen: zu affizieren und affiziert zu werden, die Kräfte auf ein Werden übertragen zu können. Es kann sich bspw. um eine Tages- oder Jahreszeit handeln, um ein Klima oder um eine Tiermeute, ein Fluß, ein Ort oder eine Schlacht, die »kein anderes Wesen« haben, »als Dinge, Tiere oder Personen, die sie bevölkern, die ihnen folgen, in ihnen schlafen oder aufwachen«.
[37] Noch in anderer Weise ließen sich eine Diesheit und ein Ereignis erfassen: »Unbestimmter Artikel + Eigenname +Verb im Infinitiv«. So ist bspw. ein »Wespe treffen Orchidee« das Ereignis, das jedes Subjekt oder Objekt, jede Form »zugunsten eines Gefüges vom Typus Haecceïtas« aufzulösen vermag.
[38]Die Diesheiten haben eine eigenständige Realität, sie selbst lassen sich nicht darauf reduzieren, Objekte/Produkte durch die Subjekte zu sein. Sie sind nicht Teil der Subjekte oder von ihnen unterteilt oder bewirkt. Da sie unordentlich sind, also: sich nicht den Subjekten und Objekten unterordnen lassen, sind sie ihnen ebensowenig gegenüberzustellen (was einer Anordnung entspräche). Was die Haecceïtas und die Anteilnahme im Block des Werdens vielmehr erforderlich machen oder verlangen, ist »eine Metamorphose von Dingen und Subjekten«. Im Zuge dieser völligen Verwandlung geschieht demgegenüber den Subjekten etwas, hier zitieren Deleuze/Guattari Maurice Blanchot, »etwas, das sie nur ergreifen können, wenn sie sich von ihrer Fähigkeit, ich zu sagen, lösen«. Ihr Hinweis lautet: »ihr könnt den Diesheiten nichts geben, ohne euch klar zu machen, daß ihr dazu gehört und nichts anderes seid«. Mit dieser Art der Individuation sind der Mensch und das Tier im Block des Tier-Werdens keine Subjekte mehr, »sondern werden Ereignisse«, die in ihrem Gefüge von den Diesheiten, etwa einer bestimmten Tageszeit, »das Nachmittag-Werden, das Nacht-Werden des Tieres […]. Fünf Uhr ist dieses Tier«, nicht getrennt werden können.
[39] Ein Geschehen und ein Ereignis, ein Werden. Mehr jedoch, als daß es eine Individuation ist, ist es eine Singularität; die Singularität eines Lebens, die gänzlich verschieden ist von der Individuation des Subjektes. Eine Singularität, die sich darin bestimmen läßt, daß sie »ein reines Ereignis« hervortreten läßt, das frei ist »von der Subjektivität und Objektivität dessen, was geschieht«. Ein Leben bezeichnet eine Mannigfaltigkeit, es reißt die Ereignisse und Diesheiten mit sich, die sich in dem Subjekt oder den Objekten und Sachverhalten nur (formalisiert) verkörpern.
[40]
5. Das Werden diagnostizierenDas Werden ist nicht mit Vergangenheit und Zukunft zu denken, es ist unhistorisch. In ihrer Philosophie wenden sich Deleuze/Guattari von der Philosophieschichte ab, arbeiten in genau dem Sinne unhistorisch, indem sie mit dem Erschaffen neuer Begriffe, dem Werden, der Kartographie, der Geo-Philosophie u.a.m. ein Denken zu befreien versuchen, das durch dualistische, dichotomische (Baum und Wurzel gegenüber dem Rhizom) oder evolutionistische Denkbilder gehindert wird, durch jene binäre Logik, die »die Mannigfaltigkeit nie begriffen« haben, oder jenes Denken, das nur imstande ist, »Gefühlsäußerungen und Handlungen auf äußere transzendente Ziele zu beziehen«.
[41] Worum es ihnen geht, das ist einen Weg zu finden, die Diesheiten nicht als »Dekoration« für oder als Reduktion auf das handelnde oder wollende Subjekt zu verfehlen, sondern das Ereignis im Prozeß und im Block des Werdens zu erfassen. Eine Forderung, die die Geschichte nicht erfüllen kann, denn »was sich gerade ereignet, das ist nicht, was zu einem Ende kommt, aber ebensowenig das, was beginnt«, es ist dazwischen.
[42] Deleuze/Guattari schreiben: »Werden aber ist der eigentliche Begriff. Aus der Geschichte erwachsend und in sie zurückfallend, ist es doch keine Geschichte. In ihm selbst ist weder Anfang noch Ende, sondern nur Mitte. Deshalb ist es eher geographisch als geschichtlich«
[43], es hat eher Zwischenräume, Kontiguitäten, Nachbarschaften und eine Koexistenz im Gegensatz zu einer zeitlichen Abfolge.
[44] Die Prozesse des Werdens, ohne die sich »nichts in der Geschichte ereignet«, aber die dennoch nicht mit ihr zusammenfallen, bekommen Deleuze/Guattaris Aufmerksamkeit, denn »was die Geschichte vom Ereignis erfaßt, ist seine Verwirklichung in Sachverhalten oder im Erleben; das Ereignis in seinem Werden […] aber entzieht sich der Geschichte«.
[45] So verkompliziert sich das Gefüge des Werdens mit der Geschichte. Einerseits die Geschichte, die Aktualisierung in oder Wiederholung von Sachverhalten, denen das Ereignis entgeht hinsichtlich seiner Individuation als Diesheit. Andererseits ist das Ereignis jedoch untrennbar mit den Sachverhalten verbunden, da es sich in ihnen verkörpert, als Bedingung oder vielmehr als eine Tatsache, aus der etwas hervorgeht. Deleuze/Guattari unterscheiden, ausgehend von Charles Péguy und Maurice Blanchot, den Sachverhalt und das Ereignis. Der Sachverhalt hat sich vollendet oder manifestiert, das Subjekt kann zu ihm einen Bezug bilden (so wie es selbst ein Gewordenes, eine Konvention ist: »Ich ist eine Gewohnheit«
[46]); das Ereignis ist demgegenüber endlos und ohne Bezug zum Subjekt, da es sich nichts und niemandem unterordnet. Entsprechend den Manifestationen des Ereignisses gäbe es die Geschichtsauffassung, die darin besteht, »neben dem Ereignis herzugehen, seine Verwirklichung in der Geschichte zusammenzusuchen, seine Bedingtheit und sein Vermodern«. Eine andere Sichtweise des Ereignisses vermag das Ereignis zu erfassen und es wiederaufzurichten, »sich in ihm als einem Werden einzunisten, […] alle seine Bestandteile oder Singularitäten zu durchlaufen«, seine Partikel zu vermengen, sich so dem Ereignis anzugleichen.
[47] Diejenige Person, die in das Ereignis (hin)eingeht, befindet sich daraufhin in einem Werden, es ist ein Anders-Werden des Philosophen, wie die Autoren in Hinblick auf Foucault sagen.
[48]»Die Werdensprozesse in jeder sich ereignenden Gegenwart zu diagnostizieren«, formulieren die anstehende Aufgabe Deleuze/Guattari in einer Anspielung auf Nietzsche und fragen: »welche Werdensprozesse durchqueren uns heute, die in die Geschichte zurückfallen, aber nicht von ihr herkommen, oder vielmehr: die von ihr nur herkommen, um aus ihr herauszukommen?« Und das Interesse an solcher Diagnose, am Werden, dürfte für sie darin liegen, daß es vorkommen kann, »daß in der Geschichte sich nichts ändert oder zu ändern scheint, aber im Ereignis ändert sich alles, und wir ändern uns in ihm«.
[49] Es gilt zu erkennen, »wodurch und wohin das System sich bewegt, wie es wird und welches Element die Rolle der Heterogenität spielt, des Körpers, der das Ganze schließlich auseinanderjagt, der die symbolische Struktur ebenso sprengt wie die hermeneutische Deutung, die laienhafte Ideenassoziation und den imaginären Archetyp«.
[50] So daß wir uns fragen müssen, was sich ändert oder wie es vonstatten geht, daß wir uns mit dem Ereignis verändern, daß sich alles verändert. »Was ist passiert?«
[51]
6. Die vermögende Kunst»Etwas passiert von einem zum anderen« in einem Werden, anstatt sich vom einen in das andere zu verwandeln. Das, was geschieht, markiert die Unbestimmtheitszone, die Ununterscheidbarkeit von Mensch und Tier, die untrennbare, gleichzeitige Bewegung des Werdens. Es ist die Errichtung eines Bereichs, »in dem man nicht mehr weiß, wer Tier und wer Mensch ist«.
[52] Es soll im folgenden um die Kunst gehen, die diese Zonen der Ununterscheidbarkeit von Mensch und Tier, von Farben, Tönen, Partikeln und Linien, diese Blöcke und Prozesse des Werdens errichten und zeigen kann. Die Kunst vermag die Frage nach dem, was passiert und sich ereignet, zu stellen als auch zu beantworten, besteht doch Anlaß, gerade in einer Bezogenheit dessen, was sich ändert, und dessen, was bleibt, sowie in der Verbindung mit dem, was sich entzieht oder flüchtet, eine Möglichkeit aufzuspüren, das Werden und die querlaufende Neuausrichtung nachzuvollziehen.
[53]Wenn ein »Wespe treffen Orchidee« passiert, geschieht es aufgrund, oder besser: nicht ohne das Bestehen eines Gefüges, eines Bezogenseins. Ein Block, der wie Spinnennetz und Fliege für- oder ineinander ein Gefüge bildet, das Deleuze/Guattari als kontrapunktisch bezeichnen: »Diese kontrapunktischen Beziehungen verbinden die Ebenen, bilden Empfindungskomplexe und Blöcke und bestimmen Werdensprozesse«.
[54] Die Kunst erschafft für dieses Bezogensein einen Bereich, in dem sie – und eine Zone, mit der sie – Mensch und Tier anhand ihrer Komponenten ununterscheidbar werden läßt. Sie komponiert, fügt Mannigfaltigkeiten zusammen, und erhält diese Kontiguität durch die Änderung, die mit diesem gesamten Gefüge im Werden passiert. Eine völlige Verwandlung eines Zusammentreffens, das durch eine unauflösliche Nachbarschaft der Farben, Töne oder Worte bestimmt ist. Doch muß sie zugleich etwas anderes geben können, etwas, das nicht nur die Wespe, die Orchidee oder die Komponenten beider betrifft: man könnte sagen, das Kunstwerk müsse wirken oder funktionieren – d.h. daß es weniger den Objektstatus repräsentieren soll (etwa in der Abbildung eines Sachverhaltes, einer Figuration von Begebenheiten u.ä.), sondern es soll die Diesheit spürbar machen, werden lassen: So muß man fühlen. Eine Empfindung, die gebildet wird durch das »Tier-Werden, Pflanze-Werden usw.«
[55]Die Kunst hat ihr Vermögen und ihre Aufgabe nicht nur darin, die Bereiche zu errichten, die die Formen auflösen, sondern »einen Block von Empfindungen, ein reines Empfindungswesen zu extrahieren«. Erschaffen wird ein Empfindungsblock auf einer Kompositionsebene, »daß heißt eine Verbindung, eine Zusammensetzung aus Perzepten und Affekten«. Das sind drei wesentliche Merkmale der Komposition der Kunst: zusammengesetzte Empfindungen, »bestehend aus Perzepten und Affekten«. Dabei unterscheiden Deleuze/Guattari von den Perzeptionen und Affektionen, als Erlebniszustände und Übergänge von einem Erlebniszustand in einen anderen, die Perzepte und Affekte. Die Kunst muß versuchen, die Perzepte den »Perzeptionen eines Objektes und den Zuständen eines perzipierenden Subjekts zu entreißen«, denn die Perzepte sind ohne Referenz, »unabhängig vom Zustand derer, die sie empfinden«. Sie muß versuchen, die Affekte den Affektionen zu entreißen, denn die Affekte sind keine Gefühle mehr, kein »Übergang von einem Erlebniszustand in einen anderen, sondern das Nicht-menschlich-Werden des Menschen«, sie »übersteigen die Kräfte derer, die durch sie hindurchgehen«.
[56] Im Tier-Werden des Menschen geschieht nicht das Nachahmen oder eine Ähnlichkeit, da es im Werden die getrennten Zustände nicht gibt, von denen der Mensch in die eines Tieres wechselt, es ist nicht das reale Tier. Im Geschehen – oder eher: dazwischen, im Werden – ist es die Empfindung, die auf Tier und Mensch trifft. Es ist deren räumliche Nachbarschaft in der Malerei (oder der Geophilosophie), die die Anteilnahme herstellt und die Deleuze/Guattari beschreiben als eine »extreme Kontiguität innerhalb einer Verklammerung zweier Empfindungen«. Es ist eine Sensationskopplung, die weder das eine noch das andere betrifft, also nicht Mensch und nicht Tier, sondern die etwas anderes betrifft oder aus ihnen herauslöst. Etwas, mit dem beide zu tun haben, wenn sie miteinander verkoppelt werden.
[57] Deleuze bezeichnet, Bacon folgend, die Sensation als »das, was von einer ›Ordnung‹ zu einer anderen, von einer ›Ebene‹ zu einer anderen, von einem ›Bereich‹ zu einem anderen« übergeht. Doch es besteht hier nicht der Übergang von einem Subjekt (Objekt) in ein anderes bestimmbares Objekt, die passierende Metamorphose gleicht vielmehr der Bewegung des Blocks des Werdens entlang einer Fluchtlinie. Das Werden ließe sich als »der Übergang von einer Empfindung zur anderen« bestimmen. Es verbinden sich die Empfindungen, die in der Kunst das Ereignis erfassen sollen, mit dem Vermögen zu affizieren (die Anteilnahme der erstellten Ununterscheidbarkeitszone) bzw. in ein Werden hineinzugelangen.
[58]Zur Bestimmung der Werdensprozesse und dessen, was sich ereignet, wird den Empfindungen eine eigenständige Realität zugesprochen, die mit der Kunst spürbar werden kann. Die Empfindungen sind »Wesen, die durch sich selbst gelten und über alles Erleben hinausreichen«, sie lassen den Block des Werdens eine andere Richtung einschlagen und sind solange nicht erfaßt, wie sie den Subjekten und Objekten als immanent zugeschrieben sind. »Sie sind, so könnte man sagen, in der Abwesenheit des Menschen, weil der Mensch, so wie er im Stein, auf der Leinwand oder im Verlauf der Wörter gefaßt wird, selbst eine Zusammensetzung, ein Komplex aus Perzepten und Affekten ist«.
[59] Der Mensch hat sich von seiner bisherigen Individualisierung als Subjekt gelöst und hat, selbst ein Ereignis, eine Singularität angenommen, die von einer Diesheit oder einer Empfindung nicht zu unterscheiden ist. In der von der Kunst geschenkten Sensation wird das Ereignis/Werden in einer »Komplementarität« erfaßt: in einem Empfindungsblock werden die Werdensprozesse als Affekte und die Kräfte als Perzepte umklammert. Die Affekte sind die Prozesse des Werdens, die Perzepte machen die »sinnlich unspürbaren Kräfte, die unsere Welt bevölkern, die uns affizieren, uns werden lassen, spürbar«.
[60]
7. Sichtbarmachen unsichtbarer Kräfte, die ›Sensation‹Die Aufgabe der Malerei ist es, jene unsichtbaren oder nur flüchtig wahrgenommenen Kräfte einzufangen, sie sichtbar zu machen.
[61] Eine Operation, die über die erstellten Figuren verläuft, die nur noch Kräfte sind, oder deren wesentliche Funktion es wird, die Kräfte spürbar zu machen. Die Figur gehört zu den Grundelementen dieser Malerei, die im folgenden anhand der Deleuzeschen Studie zu Francis Bacon aufgezeigt werden sollen. Die Ausführungen zum Werden begleitend, sollen zur Koexistenz, zum Block der Bewegungen, zu den Kräften usw. einige der Rubriken dieses Buches, ›Zur Logik der Sensation‹, durchlaufen werden, um jene Überlegungen in den Gedanken zu den Bildern oder innerhalb eines bestimmten Wahrnehmens der Bilder aufzuspüren.
[62]Vor dem Malakt, bevor die Kräfte sichtbar gemacht worden sind, muß etwas anderes geschehen, um den Malakt zu ermöglichen. Das ist sicherlich, seitens des Künstlers ein Vermögen dafür aufzubauen, sich auf das Wahrnehmen der Kräfte hin zu sensibilisieren, aber es ist noch nicht das, was das Werk (und die Sensation) schenken wird. Vor dem Malakt befindet sich der Künstler bereits in einer Umgebung voller Bilder und Klischees, er »hat Dinge im Kopf oder um sich oder im Atelier«.
[63] Diese Dinge besetzen schon vor Beginn die Leinwand. Der Maler steht also nicht vor einer weißen oder leeren Leinwand, auf die er Objekte überträgt, »er malt auf bereits vorhandene Bilder«, seine Arbeit ist vielmehr, daß er die Leinwand »leeren, räumen, reinigen« muß.
[64] Die den Künstler umgebenden Bilder oder Klischees sind figurative Gegebenheiten, eine Figuration, die der Malerei vorausgeht, als solche aber gerade im Malprozeß zerstört werden muß. Zum einen sind es in der Malerei Bacons die schon anwesenden Bilder, oft Photos, nach denen er malt oder die ihm zumindest beim Malen zugegen sind, aber auch die Erinnerungen an die Personen, die die Photos zeigen. Zum anderen, im Moment, der den Malakt einleitet, sind es die Zerstörungen durch insignifikante Striche, Markierungen und Flecken, die durch ein Benutzen des Zufalls, mit Hilfe des Farbauftrags durch Werfen, Ausbürsten, Verwischen etc. erzielt werden (Diese Technik wird auch im Laufe des Malens teils immer wieder eingesetzt, um das Bild weiter voranzubringen).
Auf die Arbeitsweise Bacons hinblickend, schreibt Deleuze: »Er dringt auf diese Weise ins Klischee, in die Wahrscheinlichkeit ein. Er dringt in sie, eben weil er weiß, was er machen will«, jedoch »nicht weiß, wie ihm das gelingen soll«.
[65] Es geht bei der Auseinandersetzung, mit dem, was Kopf und Leinwand bereits besetzen, darum, »die unwahrscheinliche Figur aus der Gesamtheit der figurativen Wahrscheinlichkeiten [zu] gewinnen«.
[66] Dazu muß Bacon aus der Leinwand wieder heraustreten, und dies gelingt ihm über das Aufbringen der zufälligen freien Markierungen, die eine andernfalls entstehende Figuration, Repräsentation oder eine Übertragung der Klischees zerstören.
[67] Diese Möglichkeit in den Malakt einzutreten ist erst gegeben mit dem Erschaffen eines direkten Zugangs zu den Figuren, die einzig die Kräfte einfangen können. Erst mit dem Abtragen der Klischees und Bilder von der Leinwand (dem Auftragen der in die Figuration eingreifenden Farbe) aber entsteht das, was die Komposition (gleichzeitig) mit einer Figur beginnen läßt: die für Bacon wichtige Form des Faktischen, matters of fact. Es meint das Faktische dessen, bereits in einer untrennbaren und unlokalisierbaren Nähe zum Anderen zu stehen, bereits unauflöslich in ein (kommendes) Werden bezogen zu sein.
8. Das Diagramm und das FaktumDiese Markierungen, Striche und Flecken, die Deleuze hinsichtlich ihrer Funktion, das Bild umzuformen, die Formen aufzulösen und zusammenzufügen, Diagramme nennt, sollen die Figur entstehen lassen. Das Diagramm, das die figurativen Gegebenheiten gänzlich verwirrt, markiert somit das vollständige Sich-Verwandeln, das sich in einem Werden ereignet. Es ist eine »operative Gesamtheit der Linien und Zonen, der asignifikanten und nicht-repräsentativen Striche und Flecken«, die sich widerspenstig gegenüber dem bereits Vorhandenen zeigen.
[68] Die Figur wird nicht durch eine Kopie und Repräsentation erstellt, sie kann nur über das Diagramm, das Brechen mit der Figuration, entstehen. Das Diagramm kann viel sein: es ist, als ob man in einen Kopf, den man malt, »mit einem Mal eine Sahara, eine Saharazone einfügen würde; als ob man auf ihm eine Nashornhaut, wie unter dem Mikroskop gesehen, ausspannen würde, als ob man zwei Teile des Kopfes mit einem Ozean auseinanderreißen würde«.
[69] Es erzwingt eine »Zone von Ununterscheidbarkeit oder objektiver Unbestimmtheit zwischen zwei Formen […], von denen die eine schon nicht mehr, die andere noch nicht« ist.
[70] Diese Operation ist wie eine Art Übergang, oder eher noch: eine Veränderung von den figurativen (oder in Hinblick auf die Aktualisierung in Sachverhalten: konventionellen) Formen, hin zu neuen Formen, die die Kräfte, oder das sich immer neu ereignende Ereignis einfangen können.
Das einsetzende Diagramm ist eine hereinbrechende Katastrophe, »das Auftauchen einer anderen Welt«, die ›faktische Möglichkeiten‹ in das Gemälde einführt.
[71] Diese müssen erst zum Faktum entwickelt werden, durch eine ihnen eigene Umwandlung in ein Element des Bildes, um die Figur aus ihnen erwachsen zu lassen. Das Gemälde beginnt erst, es kann sich erst den neuen Anzeichen der Kräfte öffnen, erst ein Ereignis erfassen (statt einzig einen Sachverhalt aufzugreifen), wenn ihm ein Kampf gegen die Klischees geglückt ist. Es ist also mit der Figur eine Faktizität entstanden, mit der die durch die zufälligen Markierungen ins Bild gebrachten informellen Kräfte verteilt werden können – verteilt über die dann folgenden grundlegenden Elemente des Bildes, die miteinander in Beziehung treten werden.
9. Figur, Fläche und KonturDeleuze definiert als drei Grundelemente der Gemälde Bacons: Figur, Fläche und Kontur. Dabei vollzieht Deleuze in seiner Beschreibung der Arbeiten Bacons mehrere Bewegungen, die den Prozeß des Malens, die Synthese der Elemente einerseits und die Analyse dieser Aspekte andererseits verbinden. Von den zufälligen Markierungen ausgegangen und beim Faktum des Bildes angelangt, verläuft der folgende Abschnitt zur Figur und daraufhin zu den umgebenden Elementen, zu Farbfläche und Kontur gehen.
Das Entstehen der Figur ist an die Markierungen gebunden, die zu Beginn auf die Leinwand gebracht wurden. Worin sich die gebundene Figur nun befindet, ist ein Schauplatz, ein Rund oder Parallelflach, die sich mit der Figur aus den Diagrammen ergeben haben. Dieser Ort erinnert teils an Gerüste oder erscheint als eine schwebende oder auf dem Boden liegende, teppichähnliche, fast geometrische Figur. Zudem kann der Schauplatz ersetzt oder verdoppelt werden durch einen Stuhl, einen Sessel oder ein Bett. In dieser (Ver-)Bindung wird die Figur an ihrem Ort isoliert. Auf diese Weise umschreibt Deleuze in den Bildern das Auftauchen des Faktums: »Kurz, das Gemälde enthält eine Bahn, eine Art Zirkusarena als Schauplatz. Es ist dies ein ganz einfaches Verfahren, das in der Isolierung der Figur besteht. […] Das Verhältnis der Figur zu ihrem isolierenden Ort oder Schauplatz definiert ein Faktum: Tatsache ist…, was stattfindet…«.
[72] Was gemalt wird, sind Figuren, »die auf demselben Faktum emporwachsen, ein und demselben einzigartigen Faktum zugehören«, sie sind auf einem Parallelflach, vielleicht einem Teppich festgestellt, ruhen auf einer Matratze, scheinen allein durch die Schwerkraft an einen Stuhl oder Sessel gebunden. Das ist die erste Funktion der Figur und die Bestimmung des Faktums, das erst die Figur ermöglicht: die Figur wird auf diese Weise isoliert, also in einer Isolation/Isolierung erschaffen, so daß sie an nichts weiter gebunden ist. Die Figur verweist auf keinerlei Objekte in einem Figurations- oder Repräsentationszusammenhang mehr, da sie einzig dem zu Beginn des Malaktes Passierenden entstammt, für das es keine Relationen oder andere Festigkeiten gibt. Das wird ebenso deutlich gemacht für die Paare, vor allem in den Triptychen Bacons, auch für sie gilt: sie entstehen aus einem einzigen gemeinsamen Faktum, das jedoch einen neuen Typ von Beziehungen realisieren soll, der sich nicht auf eine Geschichte der oder zwischen den Figuren beziehen läßt. Die Operation der Isolierung hat mit einer Tatsache, einem Ereignis zu tun, mit dem, was stattfindet oder passiert. In diesem Malprozeß, vom Ausbrechen aus der Leinwand bis zum Erschaffen der emporwachsenden Figur, dient das Faktum dazu, in das Gefüge des Ereignisses zu gelangen. Gleich der Zickzackbewegung der rhizomatischen Linien, der querlaufenden Bewegung im Werden, ist das Faktum das Pendant der Leinwand, wenn die bestehenden und neuen Formen dank des Faktums unauflösbar »in ein und dieselbe Figur gefaßt, in eine Art Schlangenlinie genommen werden, uns zwar als ebenso viele Zufälle, die um so notwendiger wären und aufeinander klettern würden«.
[73] Das Diagramm ändert das Gefüge ab und setzt es in (eine neu ausgerichtete) Bewegung.
Das zweite Grundelement, welches annähernd den Rest der Leinwand einnimmt, sind die großen Farbflächen, die Deleuze hinsichtlich ihrer Funktion im Gemälde auch materielle Struktur nennt. Meist sind es eine oder zwei monochromatische Flächen, die die Figur, die inmitten der materiellen Struktur plaziert ist, umgeben. Die Flächen sind »kein Grund, aus dem die Form heraustreten würde«, sie haben »eine strukturierende, verräumlichende Funktion. Aber sie liegen nicht unter der Figur, hinter oder jenseits von ihr. Sie liegen strikt daneben oder eher rundherum«.
[74] Im Gegensatz zu der Figur, die in verschiedenen, oft gebrochenen Tönen gemalt ist und in Verbund mit den fleckigen, verwischten Partien des Diagramms steht, sind es große einfarbige, oft klare und leuchtende Farbflächen. Doch wird dieser Gegensatz aufgelöst, indem diese unterschiedlichen Farbaufträge nicht gegeneinandergestellt bleiben, sondern vielmehr aufgrund ihrer Verschiedenartigkeit im gesamten Bild, in ihrer Komposition zusammengebracht werden können. Deleuze bezeichnet es als eine Korrelation von Figur und Fläche auf derselben gleich nahen Ebene, eine Korrelation, die durch das dritte Bildelement erlaubt ist: die Kontur. Sie liegt zwischen den ersten beiden Bildelementen und schafft eine Verbindung zwischen ihnen, die durch das Rund oder den Schauplatz, oder oft durch die Konturen und Ränder der Figuren gegeben ist. Hervorgehend aus der entstehenden Komposition, die einzig aufgrund der Möglichkeit einer De- und Rekomponierung, bei gleichzeitiger Änderung der Maßeinheit (die Verwirrung des Diagramms), zu erhalten ist, ermöglicht die Kontur das Bestehen der gleich nahen Ebene und auf ihr die Verbindung der Elemente. Sie ist dem Diagramm als einem Mal des Entstehungszusammenhangs am stärksten verbunden, in dessen Wirkmächtigkeit sie die Elemente nicht nur in eine Zone der Nähe, sondern zugleich und vielmehr in die der Unbestimmbarkeit bringt. Das Diagramm hat einem Ereignis gleich eine Linie gezogen (Kontur), eine Richtung eingeschlagen, die die Komponenten des Bildes ununterscheidbar macht.
Die Kontur bildet die gemeinsame Grenze beider, eine Membran, in deren Funktion sie der Ort einer doppelten Bewegung ist, eines Austausches in beide Richtungen auf der von ihr erstellten Bahn, zwischen Figur und materieller Struktur. »Etwas passiert, in die eine oder in die andere Richtung«.
[75]
10. Die Koexistenz der BewegungenDeleuze zieht, hier folgt der zweite Abschnitt des Verlaufs, die Linie weiter von den Bildelementen über die Kontur zu den zwei Bewegungen, die das Ensemble der Elemente und die Komposition des Gemäldes vervollständigen. Eine erste Bewegung, der Schaffung der Figur nahestehend, jedoch nicht von ihr herrührend, sondern von Kräften des Außen, führt von der materiellen Struktur, von der Farbfläche zur Figur. In ihr erfährt die in ihrer Isolierung befindliche Figur das Umschliessen der Fläche, die ihr als materielle Struktur schon einen Aufenthalt bietet: Dieser Kraft ausgesetzt wird sie sowohl auf den Schauplatz als auch an ihr Faktum gebunden, aus denen sie entstammt und entsteht. »In vielen Gemälden wird die gleichmäßige Farbfläche geradezu von einer Bewegung ergriffen, durch die sie einen Zylinder bildet: Sie rollt sich um die Kontur, um den Schauplatz zusammen; und sie umwickelt, umfängt die Figur«. Die Figur beweist in dieser Einschliessung »bereits eine einzigartige Athletik«, sie begleitet diese Bewegung »mit all ihren Kräften«. Dieser Kraftaufwand reicht hinüber in die andere, mit der ersten koexistierende Bewegung, die »demgegenüber von der Figur zur materiellen Struktur, zur Farbfläche« verläuft.
[76] Man kann es, grob verkürzt, so beschreiben: Im Zuge ihrer Entstehung, also der notwendigen und unlösbaren Beziehung zum Faktum und zur Fläche, wächst die Figur gleichsam weiter aus dem Faktischen (auf dem Diagramm) empor. Ihre Einschliessung oder Nötigung begleitend, versucht sie sich mit ihrer Umgebung zu rekomponieren. Es ist eine Gleichzeitigkeit der Bewegungen, die aus einem Zusammentreffen, einem Ereignis herrühren, wobei jedoch Deleuze der zweiten, fliehenden Bewegung eine andere Aufmerksamkeit schenkt. Ist die erste Bewegung noch die Erlangung der Figur (nach der Überwältigung der Figuration), auf die die Kräfte einwirken, richtet sich die zweite Bewegung neu aus und löst die Figur auf. Die Funktion der Fläche in der ersten Bewegung, in ihrer Mitte der Figur Zusammenhalt oder Aufenthalt zu bieten, steigert sich sogar in der zweiten Bewegung dazu, daß die Figur es darauf anlegt, ihn der Fläche oder im Gemälde vollkommen enthalten zu sein.
Die Figur ist in den Werken Bacons der Körper, der vom Schauplatz umfasst wird, er wendet Kraft und »Anstrengung auf sich selbst, um Figur zu werden. […] Der Körper müht sich oder wartet eben darauf daß er entkommt. […] stets der Körper, der durch eines seiner Organe zu entkommen versucht, um sich mit der Farbfläche, der materiellen Struktur zu vereinigen […], der durch diesen oder jenen auf der Kontur lokalisierten Punkt entwichen ist«.
[77] In dieser Koexistenz und Kontiguität wird der Schauplatz der ersten Bewegung der Ort des Ereignisses (bzw.: das Ereignis) der zweiten Bewegung. In den Bildern geschieht etwas, das zum Ereignis und zum Werden führt.
Die gesamte materielle Struktur steht zur Figur in einer Verbindung, die die Elemente auf einer gleich nahen Ebene erscheinen und in Beziehung treten läßt. Dabei übernimmt die Fläche die Bewegung/die Kräfteverhältnisse des Bildes, die sie an die Figur weitergibt. Die in die Komponenten eingelagerten Kräfte, die aus dem Brechen mit vorhandenen und dem Hervorbringen neuer Formen entstammen, nötigen zu dieser einen gemeinsamen Bewegung, in der sich in den Bildern Bacons eine Verwandlung der Figur in einer transversalen Richtung, getrieben und resultierend aus komplementären Bewegungen, ankündigt (die Athletik, die der doppelten Bewegung entspricht).
[78] Jedoch ist dafür näher zu erkunden, was die Bewegungen zustande kommen läßt und was die zur Bewegung gebrachten Figuren erfahren.
11. Die Deformationen der KräfteDer Körper in der Malerei Bacons wird von Bewegungen durchlaufen, doch ist Bacon viel eher daran interessiert ist, was an der Bewegung fortbesteht. Das Warten und die Anstrengung der Figur, durch einen Fluchtpunkt in der Kontur zu entkommen, um sich in der Farbfläche aufzulösen, die sich beide um den Körper schließen: Das ist die Gleichzeitigkeit der Bewegungen. Es sind »äußerstenfalls« Bewegungen auf der Stelle, die Spasmen gleichen, Anstrengungen in einer lächerlichen Athletik, in der Figur und materielle Struktur ihre gegenseitigen Kräfte erfordern.
[79] So daß das Gemalte gleichsam »eine Bewegung von Bewegungen oder ein komplexer Zustand von Kräften« ist. Anders gesagt, stehen die Bewegungen und die Elemente »nun in Bezug zu Kräften, alles ist Kraft«.
[80] In der Malerei Bacons sind die Bewegungen den Kräften untergeordnet, von denen sie herrühren; bei ihm sind es nicht Transformationen des Körpers von etwas in etwas. Deleuze macht deutlich, daß es sich um Deformationen handelt: es ist die Wirkung unsichtbarer Kräfte auf den Körper, die Bacon in den verwischten Partien an den Köpfen und Körpern sichtbar zu machen versucht, wenn dort die Kräfte auftreffen und einwirken. Die Deformationen, die sich im Durchgang durch die Bewegungen zeigen, lassen eine Zone der Unbestimmbarkeit der Formen entstehen. Der Aspekt der Malerei liegt damit mehr in dem, was die Bewegungen mithervorruft: die materielle Struktur trägt die Isolationskräfte, die sichtbar werden, wenn sie sich mit der Kontur um die Figur rollt, die Auflösungskräfte sind sichtbar, wenn die Figur sich mit der Farbfläche vereinigt. Es sind Deformationskräfte, die den Körper (oder den Kopf) heimsuchen, der sich in den »natürlichsten Haltungen […] je nach der bloßen Kraft, die auf ihn einwirkt, umordnet – Lust zu schlafen, sich zu erbrechen, sich umzudrehen, möglichst lange im Sitzen aushalten etc.« Wie macht Bacon die Kräfte sichtbar? Die Körper sind gekennzeichnet durch eine »außerordentliche Unruhe«, die »von Kräften des Drucks, der Ausdehnung, der Kontraktion, der Abplattung, der Streckung« kommt.
[81] Deformationen, deren verwischte und ausgebürstete Markierung unterstützt wird durch den chronochromatischen Körper (im Unterschied zur umgebenden monochromatischen Farbfläche). Was Bacon so festhält, sind Kräfte einer sich »verändernden Zeit durch die allotrope Variation der Körper«, eine ›Zehntelsekunde‹, in einer ewigen Zeit, alle möglichen Haltungen, Variationen des Körpers.
[82] Das Geschehen eines Augenblicks, oder vielmehr der Augenblick zwischen zwei Geschehnissen.
Es ist nicht einfach ein Wechsel von der Bewegung zu den Kräften, den Deleuze hier vollzieht, sondern es ist eine gemeinsame Sache, deren Zusammensetzung wesentlich einem weiteren Moment geschuldet ist, denn die Kräfte stehen in einem engen Bezug zur Sensation.
[83] »Eine Kraft muß sich auf einen Körper richten […], damit es eine Sensation gibt«. Die Sensation ist gleichsam das Einwirken der Kräfte: die unspürbaren Kräfte lassen sich nur als Sensationen spüren (das ist die Aufgabe der Kunst).
[84] Die auf den Körper einwirkenden Kräfte sind der ›Komplex von Kräften‹, der eine Koexistenz oder ›Bewegung der Bewegung‹ hervorruft, die Figur, Fläche und Kontur betreffen. Etwas tritt hinzu: Was an der Bewegung fortbesteht (das ist Bacons Interesse an den Kräften), wird durch die Sensation bestimmt – es sind die Kräfte, die die Bewegungen zu überdauern scheinen und den größten Zusammenhalt der Elemente geben können.
[85] In ihnen, so ließe sich vermuten, kommen die Formen, Partikel geworden, am nächsten zueinander.
Der Ort, auf den die Kräfte einwirken, ist der Körper. Er ist zugleich die wesentliche Bestimmung der Figur: sie ist keine Form, »die auf ein Objekt bezogen ist und dieses wiedergeben soll (Figuration)«, sondern sie ist demgegenüber als eine »auf die Sensation bezogene sinnliche Form« bestimmt, sie ist als Körper dem Geschehen, dem Ereignis ausgesetzt, deren Singularitäten sie durchläuft. Der so aufgelöste Körper ist als Figur »bereits ›akkumulierte‹ ›geronnene‹ Sensation«, er ist Empfindung.
[86] Der Körper wehrt sich gegen die strukturierende Haltung, der er unterworfen ist; die er aber abzuschütteln versucht. Er ist ›organloser Körper‹ (Artaud), der »von einer Welle durchströmt» wird, die in ihm »Ebenen und Schwellen einzeichnet«, ihn bestimmt die »vorübergehende und provisorische Gegenwart bestimmter Organe«, die durch das Einwirken oder Auftreffen einer deformierenden Kraft auftreten und jene allotropen Variationen des Körpers ausmachen.
[87]Es geschieht in diesem Kräftekomplex etwas, das Deleuze selbst in den Bezug zum Faktischen, oder wie zu erweitern wäre: in Bezug zum Ereignis stellt. »Was aus der Deformation ein Schicksal macht, ist die Tatsache, daß der Körper einen notwendigen Bezug zur materiellen Struktur besitzt:« Die Figur ist nicht nur isolierter Körper, sondern »bald kontrahiert und angesogen, bald gestreckt und gedehnt«, es ist der deformierte Körper, der unter Einsatz aller Kräfte entweicht. Die materielle Struktur »rollt sich nicht nur um ihn zusammen, er muß sich vielmehr mit ihr vereinigen und sich in ihr auflösen und dazu durch oder in jene Prothesen-Instrumente passieren«, die bei Bacon ein Spiegel sein können, der den Kopf deformiert, oder ein Waschbecken, durch das der Körper zu entkommen versucht, ein Schatten oder Farbstrich, der sich aus der Figur in die Farbfläche erstreckt.
[88] In einer Koexistenz, in einer unauflöslichen Beziehung besteht zwischen den Organen, einem Kopf und anderen Gegenständen, einer Kloschüssel, einem Vogel u.ä. kein Unterschied mehr. Es hat sich alles in eine neue Beziehung zueinander gebracht, die weniger auf Ähnlichkeit beruht als vielmehr auf einer der Sensation geschuldeten Zone der Nachbarschaft oder Ununterscheidbarkeit.
12. Tier-WerdenWas geschieht ist ein Werden. Das Streben des Körpers, zu entkommen, das der Figur, sich durch die Kontur hindurch in der Farbfläche aufzulösen, geschieht in einem Werden. »Die Kontur verändert sich, wird zur Halbkugel des Waschbeckens oder Regenschirms, zur Dichte des Spiegels und wirkt deformierend; die Figur kontrahiert oder dehnt sich, um durch ein Loch oder in den Spiegel zu kommen, in einer Reihe krasser Deformationen erfährt sie ein ungewöhnliches Tier-Werden«.
Deleuze nimmt eine Einteilung vor: der Körper (sowie der Kopf als Teil des Körpers) ist Figur, Struktur hingegen sind die Knochen und das Gesicht. Bacon ist Maler von Köpfen, nicht von Gesichtern, er versucht, den Kopf unter dem Gesicht, das eine »strukturierte räumliche Organsisation« ist, hervorzuholen. »Das Gesicht auflösen, den Kopf unter dem Gesicht wiederfinden oder auftauchen lassen«, eine Operation, die auf die Bevorzugung des Fleisches gegenüber den Knochen verweist, die Deleuze bei Bacon beschreibt: »Es gibt keinen Zweifel, das Fleisch ist der höchste Gegenstand des Erbarmens bei Bacon, […] es hat alle Leiden bewahrt. […] Bacon sagt nicht ›Erbarmen mit den Tieren‹, sondern eher: jeder Mensch, der leidet ist bloßes Fleisch. Das Fleisch ist der gemeinsame Raum von Mensch und Tier, ihre Ununterscheidbarkeitszone, es ist jenes ›Faktum‹, eben jener Zustand, in dem sich der Maler mit den Gegenständen seines Schreckens oder seines Mitgefühls identifiziert«.
[89]Es wird in den Gemälden Bacons eine »Zone von Ununterscheidbarkeit, Unentscheidbarkeit« konstituiert, »das gemeinsame Faktum von Mensch und Tier«. Es sind keine »formalen Korrespondenzen« mehr, die zwischen Tier und Mensch bestehen, keine bestimmbaren Einheiten, keine Kombination von Formen. Es ist, greift man auf die vorangehenden Überlegungen zurück, das, was zwischen ihnen passiert. »Es kommt vor, daß etwa ein wirklicher Hund als Schatten seines Herrn dargestellt wird; oder umgekehrt der Schatten eines Mannes eine autonome und unbestimmte Tierexistenz annimmt. Der Schatten entflieht dem Körper als ein Tier, das in uns wohnt«. Der Schatten als ein dazwischen, das den Block aus ›Mensch‹ und ›Tier‹ eine neue Richtung einschlagen läßt. Ein Block, ein Komplex von Kräften, der von der Nähe oder den Partikeln herrührt, und der eine andere Ausrichtung vorgibt durch das gemeinsame Faktum (durch ein Ereignis, das Gefüge der Diesheiten). Und zugleich geschieht etwas mit Mensch und Tier, etwas, das sich aus beiden herauslöst: Die Fluchtlinie, die sich über das Tier hinaus erstreckt und das Tier etwas anderes werden läßt, richtet sich aus auf etwas, das irgendetwas sein kann, Farbe oder Ton, ein Schatten oder ebenso ein Geist.
[90] Es könnte als Anstrengung aufgefasst werden, in einem Zwischen das Außerhalb aufzudecken. Deleuze merkt zur Bestimmung der Baconschen Figuren an, daß es dem Körper/dem Kopf nicht an Geist fehlt, »es ist dies aber ein Geist, der Körper ist, […] ein Tiergeist, er ist der Tiergeist des Menschen: ein Schweine-Geist, ein Büffel-Geist, ein Hunde-Geist, ein Fledermaus-Geist…«. Die verwischten und ausgebürsteten Portraits und die Deformationen der Figur, die Partien, auf die die Kräfte deformierend einwirken, sind Momente des Kampfes mit den Formen, die auch im weiteren das Bild noch steuern. Aus den zufälligen Markierungen, den Strichen und Flecken wird der Prozeß eines anderen Werdens. »Die Marken oder Züge des Tierischen sind nicht länger Tierformen, sondern eher Geister, die die verwischten Partien heimsuchen, am Kopf zerren« und diesen unter dem Gesicht auftauchen lassen, Geister, die den von den Knochen fallenden Körper flankieren. »Es kommt vor, daß der Menschenkopf durch ein Tier ersetzt wird; dies ist aber nicht das Tier als Form, vielmehr das Tier als Strich oder Zug, etwa ein zitternder Vogelstrich, der auf der verwischten Partie herumwirbelt.« Und tatsächlich: es ist die Farbe oder ein Geist, der herumwirbelt, ein Vogel-Geist oder ein anderer Geist, Geist des Menschen, die herumzuwirbeln vermögen – und nicht ein Vogel, der doch eher fliegt oder hüpft. Es ist eine völlige Umformung in einer »unförmig unförmigen Bewegung«, es ist ein Vogel-Werden des Menschen, wenn der Vogel Farbe und Pinselstrich wird, und es ist ein Geist-Werden genau dann, wenn der Vogel ›als‹ Strich in der Art der Geister herumzuwirbeln beginnt.
[91]Was sich in den zwei (zuvor unterschiedenen) Termen nicht, und in ihrer zweiseitigen Beziehung genausowenig erfassen ließ…, vielleicht erfassen Fluchtlinie, Diagramm und Kontur diese neue, transversale Bewegung.
[92] Anhand der Malerei Bacons ließe sich die alterierende Bewegung dahingehend bestimmen, daß sie gefasst als Diagramm und Kontur (immer mehr) in das Gemälde eingebracht wird. Als zufällige Markierung hat sie die zur Ununterscheidbarkeit gebrachten Formen (von Mensch und Tier) erstellt, als Strich oder Zug (Farbe geworden) löst sie sich doch von diesem Prozeß und läßt etwas anderes entstehen, das das Geschehen insgesamt vollkommen abändert. Die Farbe, der verwirbelte Strich und der herumwirbelnde Geist treten zu Mensch und Tier hinzu, sie belassen es jedoch nicht bei der Ununterscheidbarkeit von Mensch und Tier, sondern verwischen dieses Paar und richten Tier und Mensch neu (auf sich) aus.
13. Gleichzeitigkeit eines anderes Werden, die WahrnehmungDie Figur, die sich konstituiert in der einen Bewegung durch die einschliessende Farbfläche und sich mit ihr vereinigt in einer zweiten entkommenden, ›fluchtenden‹ Bewegung, ist gleichsam wie ein Form werdender Körper, der jedoch in diesem Werden zur Form dazu beiträgt, daß sich die Form selbst aufzulösen beginnt.
[93] Das Auflösen der Formen ist Aufgabe der Kunst, die ihre Ununterscheidbarkeit herstellt. Bei Bacon ist es nicht eine Form auf einem Hintergrund, sondern das Ineins-Werden der Figur-Form in der benachbarten materiellen Struktur in einer Reihe von Deformationen und Kräfteeinwirkungen. Eine Zone der Ununterscheidbarkeit, festgehalten an oder in den Markierungen im Bild, die Schauplätze des Werdens und Male des Ereignisses sind. Die Form (des Menschen wie des Tieres) löst sich auf, sie wird vielmehr »Strich oder Zug, etwa ein zitternder Vogelstrich« – exakt in dem Augenblick, »in dem der Vogel dabei ist, etwas anderes zu werden, reine Linie und reine Farbe«, ein anderes Werden, ein Anders-Werden des Tier-Werdens.
[94] Was geschehen ist, das ist ein gleichzeitiges Werden des Menschen zum Tier, des Tieres zum Pinselstrich
[95] und zur reinen Farbe – oder: In einem doppelten Werden ist es der (Tier-werdende) Mensch, der in diesem Linienzug oder jener Farbe aufgeht. »Die Farbe in Abwesenheit des Menschen, der in Farbe übergegangene Mensch«, schreibt Deleuze, und weiter (Cézanne zitierend): »›Der Mensch soll nicht da sein, aber ganz eingegangen in die Landschaft‹«.
[96] Was zugleich geschieht, ist ein Molekular-Werden oder eine Annäherung an ein Unsichtbar-Werden, da es eine Auflösung in Partikel gibt, eine Auflösung hin auf ein gemeinsames Faktum, das die Ununterscheidbarkeit in die Komposition einführt.
[97]Parallel zum Aufbau des Bildes durch Elemente auf derselben gleich nahen Ebene, beschreibt Deleuze für die Malerei Bacons, wie eine neue Art des Sehens für das Wahrnehmen des Geschehens auf dieser Ebene ermöglicht sein muß: ein naher, taktiler oder vielmehr haptischer Blick, der die so nebeneinandergefügten Elemente erfassen kann. Dieses Erfassen ist weder einer physikalischen Optik, noch einem rein manuellen Ergreifen untergeordnet. Es ordnet nicht mehr hinsichtlich einer Perspektive an, vielmehr könnte es als eine Weise verstanden werden, sich einem Gemälde, einer geschenkten Sensation auszusetzen, sich einem Werden mit dem Bild zu öffnen.
[98] Die Malweise Bacons löst die Figur in der Fläche auf, sie zieht die Elemente auf eine haptische Ebene, mit der der Betrachter zugleich erfasst ist, er erfasst das Gemälde und die Sensation, wenn er sich auf die Ebene einlassen kann, von der aus er in ein Landschaft-Werden gerät. »Die Landschaft sieht«.
[99] Beide, Figur und Betrachter, erfahren das Geschehen, ohne sich davon distanzieren zu können. In der Sensation werden das Ereignis, der Schauplatz und das Faktum mit dem Körper unauflöslich verbunden, ein untrennbarer Block: »Ich werde in der Sensation, und zugleich geschieht etwas durch die Sensation, das eine durch das andere, das eine im anderen«.
[100] Etwas geschieht durch die Sensation, eine völlige Umwandlung, nicht ohne daß der Betrachter zugleich in ein Werden hineingezogen wird. Auf Cézanne bezugnehmend beschreibt Deleuze die gegenstrebigen Bewegungen in den Bildern Bacons: »die Welt, die mich selbst ergreift, indem sie sich um mich schließt, das Ich, das sich zur Welt hin öffnet und sie selbst öffnet«.
[101] »Man ist nicht in der Welt, man wird mit der Welt, man wird in ihrer Betrachtung. Alles ist Schauen, Werden«.
[102] Es ist ein Aufgehen in die Farbe oder ein Aufgehen in die Welt, in dem Maße, indem das Werden auf ein Unwahrnehmbar-Werden ausgerichtet ist. Das Unwahrnehmbar-Werden gelingt, da der Mensch mit den Linien des Tieres, der Steine, einer Tageszeit oder eines Lautes eine Welt bildet. Deleuze/Guattari schreiben, daß es ein alle-Welt-Werden in dem Sinne ist, wie es im Prozeß des Werdens und seines Wahrnehmens nicht mehr darauf ankommt, eine Welt als das große Ganze zu sein (oder darzustellen), sondern eine Welt werden zu lassen und zu bilden (die Möglichkeit der Kunst). Deleuze/Guattaris Augenmerk liegt darauf, dazwischen hindurchzugehen, um den Dualismen zu entkommen, im Zwischen anzusetzen, um das Ereignis zu erfassen. Und genau dahingehend richten sie die Diagnose des Werdens: »Die Wahrnehmung verändern«. Was geschieht, läßt sich erfassen, wenn man in einem Unwahrnehmbar-Werden im Gefüge der Linien und ihrer Bewegung aufgeht. Die Bewegung selbst ist nicht wahrzunehmen, so schreiben Deleuze/Guattari, doch sie betonen zugleich: »die Bewegung ›muß‹ auch wahrgenommen werden, sie kann nicht umhin, wahrgenommen zu werden«: In der Kunst gibt es diese sich verstärkende Unwahrnehmbarkeit der aufgelösten Formen, die aber im Sichtbarmachen der unsichtbaren Kräfte (in der Malerei) vernehmbar wird; in einem Unwahrnehmbar-Werden des Betrachters ist ein Vernehmen der Bewegung/der Kräfte unvermeidlich.
[103] Das Diagnostizieren des Werdens, in dem die Bewegung geschieht, ist nur möglich in einem Werden (dem Anders-Werden des Philosophen), das die Menschen in die Bewegung hineinzieht, die dann »selbst Teil des Empfindungskomplexes sind«.
[104] Das Erfahren oder Empfinden des Tier-Werdens gelingt dann, wenn der Mensch in die Farbe übergegangen ist, um Vogel zu werden.
14. noch nicht ganz zu denken»Der Mensch wird Tier, aber er wird es nicht, ohne daß das Tier zugleich Geist wird, Geist des Menschen […]«.
[105] Mit diesem Satz schließt Deleuze im Buch zu Bacon an die Passage an, in der er die Ununterscheidbarkeitszone und das gemeinsame Faktum von Tier und Mensch aufzeigt. Es ist das Fleisch, die körperlichen Figuren, denen etwas auf der Leinwand hinzugefügt wird, Markierungen, die dem Körper entweichen, als Schatten, wirbelnder Vogel oder Geist. In den Gemälden Bacons ist dies alles zugleich, ein Augenblick ist festgehalten, der doch eine Bewegung und das Bestehen aus Kräften nicht vertuschen kann. Etwas bleibt im Bild bewahrt, das die Bewegung auf der Stelle sein könnte, die Deleuze hervorhob. Ist es dieses doppelte, scheinbar widersprüchliche, was die Faszination ausmacht? Läßt sich die im Werden oder im Tier-Werden vollzogene Bewegung zusammenfassen als die querlaufende Richtung, die der Block des Werdens einschlägt? Das alles ist in der Formulierung Deleuzes enthalten: »Der Mensch wird Tier, aber er wird es nicht, ohne daß das Tier zugleich Geist wird, Geist des Menschen« – Wie ist dieser Gedanke Deleuzes zu verstehen, wie kann diese Wendung gedacht werden? Es ist die Bewegung eines Werdens mit offenem Ausgang, eines Werdens, von dem jedoch einiges bekannt (spürbar) wurde. Etwas geschieht nämlich nicht, ohne daß zugleich etwas weiteres passiert; die Frage geht nicht dahin, was vor und nach dem Werden war, nicht zu den Sachverhalten, denn die relationierende Maßeinheit fehlt (das Werk des Diagramms, das Deleuze so hervorhebt). Zu fragen ist nach den Mannigfaltigkeiten und Diesheiten, die den Block des Werdens auf die Linie setzen, und nach dieser Fluchtlinie. Fünf Uhr ist dieses Tier! Dieses Tier ist dieser Ort! Es ist der Ort einer Nähe (auch der Ort des Zeigers auf der Uhr), der entscheidend ist (Deleuze/Guattaris Geophilosophie und Kartographie). Rückt der Mensch in diese Nähe, gerät er in eine Nachbarschaft und in ein Tier-Werden, gerät er in den Strom der Haecceïtas, erfährt er die Sensation, die seine Koordinaten verwirrt.
Wir betrachteten das Tier-Werden des Menschen, doch es sind nicht allein Tier und Mensch beteiligt, sie sind zu vernehmen mit dem Ort, der Nachmittagsstunde, mit der Farbe und Kraft des Vogels, mit dem Schatten, der entflieht. Die Bewegung ist – ein unvermeidlicher Gedankensprung – nicht losgelöst zu betrachten, sie ist keine Einheit und keine Relation; es ist ein Block. Die Formulierung Deleuzes ist als ein Block zu verstehen: ›…nicht, ohne…‹, der nicht einfach zu denken ist (sondern mannigfach). Jedenfalls ist nicht daran zu denken, daß sich Mensch und Tier in der Mitte treffen, denn das wäre der Mittelwert. Die absolute Geschwindigkeit oder die neu eingeschlagene Richtung, das ist die völlige Verwandlung, d.h. die gleichzeitige Veränderung der Terme und der Maßeinheit (das verwirrende Diagramm, die Sensation), in der ein Block bleibt und (in ihm) alles ändert. Es ist keine Beziehung von Mensch und Tier…, oder es kann solange eine Beziehung sein, die über Identifikation und Imitation (das distanzierte Ich des Menschen) verläuft, solange nicht etwas in Art eines Geistes hinzutritt, der zu spuken beginnt (die Sensation), der ärgert (das Alterieren). Ein Geist, ein Schatten, der selbst Farbe geworden oder aus Farbe ward. Das Tier-Werden ist nur als ein gleichzeitig mit anderen Arten des Werdens sich Ereignendes zu verstehen, ein Block des Werdens, der dennoch eine Drift hat: die Fluchtlinie, die alterierende Linie, die nicht das Andere ist, nichts anderes ist, die nicht wechselt oder vor eine Alternative stellt, sondern die abändert. Wie ist dieses gleichzeitige, Fluchtlinien ziehende Werden zu denken?
Es sind die Bruchstücke eines Werdens: die Zone der Ununterscheidbarkeit oder der Nachbarschaft, die noch einmal heranzuziehen sind: man hat als Mensch etwas mit dem Tier zu tun. Es gibt etwas, das von dieser Zone markiert wird, Deleuze hat es in der Malerei Bacons benannt: das Fleisch, das Leiden, der Schrecken – eine »widernatürliche Anteilnahme« (die über eine Beziehung zwischen Mensch und Tier hinausgehen). Sie definieren eine Verbundenheit oder ein Verfängnis mit dem Tier, in denen das Tier-Werden zu verstehen ist: »Man wird Tier, damit das Tier etwas anderes wird«.
[106] Und dieses Anders-Werden markiert, daß diese Verbundenheit nicht abgeschlossen ist: Man geht (als Mensch) nicht in einem Tier auf. Zuvor ist das Tier etwas anderes geworden, ob herumwirbelnder Vogel-Geist oder reine Farbe. Und was ist man als Mensch? Deleuze/Guattari fassen den Menschen als ein Komplex aus Perzepten und Affekten, in der Kunst ist er der Körper, der auf die Empfindung bezogen ist, wenn er Farbe oder ein Verlauf der Wörter wird. Wie das Werden keinen Endzustand besitzt, der das Tier wäre, so besitzt es ebenfalls keinen Anfangspunkt, der der Mensch sein könnte. Als Mensch ist man bereits in einem Werden, in einem Gefüge, für das der Mensch nicht die Einheit stiftende, übergeordnete Dimension ist.
Diese Überlegungen scheinen wichtig zu sein für ein Denken des Werdens, da es dazu veranlaßt (einzugestehen), sich neu auf die Suche begeben zu müssen. Wir befinden uns im Denken. Was heißt Denken bei Deleuze/Guattari? Das Denken kann viele verschiedene Formen annehmen: »auf jeden Fall und in allen ihren Zuständen ist die Malerei Denken: das Sehen vollzieht sich im Denken«.
[107] Die Linie des Denkens, die wieder mit Deleuzes Formulierung auftaucht, wurde bei Bacon aufgenommen. Von dort ist etwas in die Überlegungen mitaufzunehmen, was die Diagramme und die Zone der Ununterscheidbarkeit, ohne die das Werk Bacons nicht zu denken ist, betrifft: Das Diagramm ist die hereinbrechende Katastrophe (das Werden auslösende Ereignis), jedoch soll es nicht die Katastrophe auf das Bild übertragen, etwas soll aus dem Diagramm hervorgehen. Es ist die Operation Bacons, mit der er Ähnlichkeit erzeugen möchte, »aber mit zufälligen und unähnlichen Mitteln«.
[108] Deleuze betont jedoch, daß es sich bei dieser »Unschärfe« um eine Arbeitsweise »hoher Präzision« handelt (die Anstrengung), daß das Verschwommene der Bilder Bacons »nicht durch Undeutlichkeit erlangt« wird, sondern durch »die Operation, die ›darin besteht, die Deutlichkeit durch Deutlichkeit zu zerstören‹«.
[109] Es bricht, so formulieren es Deleuze/Guattari aus diesem Ununterscheidbarkeitsblock ein »Maximum an Bestimmtheit« hervor; eine Formel die sie in das, was es zu denken gilt, einbeziehen: »man braucht dringend anexakte Ausdrücke, um etwas exakt zu bezeichnen. Und zwar keineswegs, weil man da hindurch müßte, weil man nur durch Annäherungen weiterkäme: die Anexaktheit ist eben keine Annäherung, sondern im Gegenteil genau die Durchgangsstelle dessen, was im Werden ist«.
[110] Wonach wir fragen, ist dieser bestimmte Block einer Drift in einem koexistenten Werden, die sehr wohl deutlich zu spüren ist, aber einzig in ihrer Verschwommenheit.
Es sind nicht zwei Dinge getrennt von der von ihnen unterschiedenen Umgebung, in einer Einheit (der Bewegung) zu betrachten, das ist aufgrund der Verschwommenheit unterbunden; es ist keine Bewegung, ohne nicht zugleich untrennbar in/mit dem zu sein, was sie umgibt. Die Terme entstehen mit ihr und fallen zurück, entlang einer Linie, einem Ereignis ausgesetzt, das ihnen für einen Augenblick diese oder jene (unförmige) Form gibt, die ihnen aufgrund eines, wohlgemerkt flüchtigen und provisorischen, völligen Sich-Änderns zukommt. Markiert wird, was dem Gefüge hinzutritt oder es erst werden läßt: nicht nur Mensch und Tier, wenn sie nicht zugleich eins mit den Diesheiten sind, mit ihnen verschwimmen – fünf Uhr ist das Tier. Der Mensch, die Figur bei Bacon, ist der Spaziergang im Rund. Es ist ein Spaziergang, in »absoluter Ununterscheidbarkeit«, als »sich-spazieren-führen [passeggiar-sé]«, bei der es unmöglich ist zu beantworten: »wer führt wen spazieren?«.
[111]Zu fragen wäre, was sich im Denken ereignet, um das Ereignis des Werdens zu denken? Was ereignet sich und was wird mit uns im Denken? Auszugehen ist von einem Block des Werdens, einer Zone, in der die Terme ununterscheidbar sind, da sie durch eine Nachbarschaft in einen Block aufgelöst wurden, da sie sich mit den Linien der Diesheiten komponieren. In der Malerei Bacons ist diese Zone als eine Kontiguität und Umklammerung gefaßt, die Mensch und Tier betrifft. Es ist eine Bestimmtheit und Unbestimmtheit »in einem Maße, daß die isolierteste Figur Bacons bereits ein Figurenpaar ist, der in einem latenten Stierkampf mit seinem Tier verwachsene Mensch«.
[112] Wir fragen: was ist »jene Grauzone, jene Zone der Ununterscheidbarkeit, in der die Kämpfenden sich einen Augenblick auf dem Boden vermengen und das müde Auge des Denkers den einen für den anderen hält«?
[113] – Wie denken?
15. das Denken wirdFür Deleuze/Guattari ist das Denken ein Experimentieren und ein Schaffen.
[114] In diesem Sinne ist das Denken nicht einzig der Philosophie vorbehalten; auch die Malerei ist Denken. Wovon sich dieses Denken abwendet, ist ein feststehendes, dualitäres Denken, oder ein Denken feststehender Dualismen. Eine Abwendung, die gelingt, weil es ein Denken der oder in Mannigfaltigkeiten und Singularitäten ist, die das Einbeziehen des Ereignisses ermöglichen. Es geht darum, die Wahrnehmung auf das hin zu verändern, was geschieht: es verlangt, das Denken zu verändern. Ein Anders-Denken, wie Deleuze/Guattari es mit Foucault umschreiben.
[115] – Dem hinzuzufügen wäre: ein Anders-Denken gegenüber einem Denken des Anderen, für das trennbare Einheiten vorausgesetzt wurden, ein Anders-Denken gemäß der alterierenden Linie, gemäß der transversalen Richtung, die im Werden eingeschlagen wird. Das so gefaßte Denken ist verbunden mit dem Werden, das im Denken ergreift, wie die Auseinandersetzung mit der Malerei und dem Denken Bacons gezeigt hat; es ist ein Denken, das sich ereignet. In diesem Sinne ist es kein reflektierendes oder kontemplierendes Erfassen mehr (das sich distanziert von dem, was es denkt), da es selbst im Wahrnehmen dessen, was geschieht, eine Änderung erfährt. Das Denken wäre eins mit den Linien, die die Diesheiten sind. Es ist ein Anders-Werden des Philosophen oder Künstlers, der durch das Ereignis hindurchgeht und mit ihm wird, während alles sich mit ihm und den Diesheiten ändert. Man nimmt etwas in das Denken hinein, um es zu verändern: das sich Ereignende. Nimmt man damit die zu einer transversalen werdende Bewegung des Werdens auf, macht man also die Bewegung, so nur, »indem man sie denkt« und im Denken anders-wird.
[116]Das Denken löst das Ich auf, wenn es in der Malerei das Ich in die Landschaft oder in die Farbe übergehen läßt, in der es nun Geist- oder Vogel-werdend empfindet. Es ist abgelöst von einem Empfinden, das der Pinselstrich sein kann. »Ich bin nicht mehr ich, sondern eine Fähigkeit des Denkens, sich zu sehen und sich quer durch eine Ebene zu entwickeln, die mich an mehreren Stellen durchquert«, schreiben Deleuze/Guattari.
[117] Es ist ein Denken, das selbst wird und werden läßt, wenn es (wie das Werden) durch »ein kleines Detail, das mitreißt«, in eine querlaufende Richtung angestoßen wird.
[118] Die Bewegungen in der Malerei Bacons waren nicht ohne die bestehenden und einwirkenden Kräfte, nicht ohne die »›[…] Gewaltsamkeit der Farbmaterie […]‹« und die Gewalt der Empfindung zu denken.
[119] Doch was reißt in ein Denken, »welche Gewalt muß auf das Denken einwirken, damit wir zum Denken fähig werden, die Gewalt einer unendlichen Bewegung, die uns zugleich der Macht beraubt, ›ich‹ zu sagen?«
[120]Im Denken geschieht etwas, das uns werden und denken läßt; gleichzeitig passiert dem Denken etwas, es kann sich entgleiten, es »löst allgemeine Indifferenz aus«, wie Deleuze/Guattari schreiben, wenn es die Terme durcheinander bringt. Das Denken erstellt als Werdendes und vielleicht so vermögend wie die Kunst eine Unbestimmtheits- und Ununterscheidbarkeitszone, in ihm gibt es keinen Haltepunkt außerhalb eines je singulären Momentes, so daß »selbst die Frage nach einer ›Orientierung im Denken‹« ihren Sinn ändert.
[121] »›Sich im Denken orientieren‹ impliziert weder einen objektiven Bezugspunkt noch einen bewegten Körper, der sich als Objekt erfahren würde […]. Die Bewegung hat alles erfaßt, und es gibt keinen Platz für ein Subjekt und ein Objekt«, von dem sich das Denken des Werdens verabschiedet hat.
[122]Man durchläuft die Bewegungen im Denken oder denkt im Durchlaufen der Bewegungen, »man kehrt mit roten Augen zurück, selbst wenn dies die Augen des Geistes sind«.
[123] Es ist der Vogel-Geist. Es ist das Tier-Werden, das Werden des Vogels, ein Herumwirbeln am Ende der Denkbewegung, wenn man die Koexistenz und das Transversale des Werdens zu denken versucht.
»Man denkt nämlich nicht, ohne zugleich etwas anderes zu werden, etwas das nicht denkt, ein Tier, eine Pflanze, ein Molekül, ein Partikel, die zum Denken zurückkehren und es von neuem in Gang setzen«.
[124] Wie ließe sich daraufhin der Block und die querlaufende Fluchtlinie des gleichzeitigen Werdens verstehen, wenn man es durchläuft? Demzufolge denkt man nicht, ohne etwas zu werden, was nicht denkt, ein Tier, zu dem ich aber nicht werden kann, ohne daß das Tier zugleich etwas anderes wird, Geist des Menschen, der das Denken neu beginnen läßt. In einer Zwischen-Zeit, im dazwischen, passierte ein Werden, in dem die Kräfte die transversalen Richtungen freigesetzt haben, die das Denken bewegt und verändert haben. So wie man hungrig zum Hund werden kann, so gerät man ebenso denkend in ein Hund-Werden. »Und wenn das Denken auf Suche geht, so weniger nach Art eines Menschen, der über eine Methode verfügte, sondern wie ein Hund, von dem man sagen würde, er mache unkontrollierte Sprünge…«
[125] Das Denken hat keine Methode, das Denken ist nichts anderes als ein unkontrollierter Sprung, den man macht, indem oder durch das man ein springendes Tier wird (es ist keine Abfolge oder Kausalität). Es ist ein Empfinden, ein Begreifen oder ein Denken, wenn man Stein- oder Pflanze-werdend verharrt, wenn man Vogel-Geist-werdend herumwirbelt. »Es besteht keine Veranlassung, aus einem derartigen Bild des Denkens Selbstgefälligkeit zu schöpfen«, da diese Selbstgefälligkeit aus einem verhindernden Denken resultiert, das sich in dualistischer Weise von allem, was es denkt, distanzieren zu können glaubt, wenn es weiterhin auf die Imitation und eine eigenmächtige Beliebigkeit setzt. Denn die exemplifizierten Ereignisse sind ein Werden, »das viele ruhmlose Leiden mit sich bringt und anzeigt, wie sehr Denken immer schwieriger geworden ist […]«
[126] – »Das Denken selbst ist manchmal einem verendenden Tier näher als einem lebenden Menschen«.
[127]
16. AnmerkungenAnzumerken oder anzuzeigen ist, daß sich die Arbeit mit dem Werden u.ä. herumschlägt und so von einem Kapitel zum anderen entlanghangelt, die allein nur notdürftig durch Überschriften zusammen- bzw. auseinandergehalten werden. Die Arbeit hat indes eine Richtung genommen, die die Überlegungen zum Werden auf diese Weise zusammengefügt hat, ohne daß dabei Rücksicht auf eine strikte Trennung genommen wurde, die in einem Teil Deleuze/Guattari, und in einem anderen mich sprechen läßt. Vielleicht ist dieses Zustandekommen durch die Verunmöglichung dessen nötig geworden, nicht ›über‹ etwas zu reden, vielleicht auch durch die Weigerung, anhand der vorhandenen Literatur ein Denken oder eine Interpretation ›über‹ Deleuze/Guattari in den Dreck zu ziehen (wenngleich das nicht konsequent verfolgt worden ist). Der hier unternommene Versuch wäre womöglich zu beschreiben, indem man sich auf eine Weise einließe, in ein Denken hineinzugelangen und wieder aus ihm herauszukommen. Dieses allerdings nicht mit der Intention, es distanziert abzustreifen, sondern um ›mit‹ dem Denken etwas zu veranstalten.
Wenn man das Ende der Arbeit mit Zitaten schließt, in denen die behandelten Autoren zu Wort kommen mit einem Hinweis auf die Schwierigkeiten des Denkens, so wäre dem vielleicht noch etwas hinzuzufügen. Was auch immer im Denken betrieben worden sein mag, es ist unmöglich, das Denken auf einen Punkt zu bringen, mit dem es abzuschließen wäre. Dieser Umstand ist sicherlich nicht einwandfrei zu begrüssen – ich muß zugeben, das er mir letztenendes zu schaffen machte –, doch ist ihm, auf gelungene Weise oder nicht, Rechnung getragen. Das Denken ist weiterhin aufzunehmen, und das hier Verfasste kann nur ein Ausschnitt, eine Facette dessen sein, dem Werden bei Deleuze/Guattari zu begegnen. Einige Gedanken können nur aufgereiht werden:
An einer Stelle erwähnen Deleuze/Guattari, daß es nicht darauf ankäme, »an einen Punkt zu kommen, an dem man nicht mehr Ich sagt, sondern dahin, wo es belanglos wird, ob man Ich sagt oder nicht«. Und weiter heißt es: »Wir sind nicht mehr wir selbst«.
[128] In der Zwischen-Zeit hat sich etwas ereignet, die Drift eines Werdens läßt die Terme nicht sie selbst werden. Das Denken mag von neuem beginnen – wir wissen, es wird rhizomatisch in der Mitte anfangen und an abgerissenen Linien ansetzen –, doch es ist etwas passiert, einer Katastrophe oder einem Diagramm gleich, das uns auf eine neue Bahn gesetzt hat, für die die Maßeinheiten nicht mehr dieselben sind.
[129] Ob Ich oder nicht, es ist nicht gegenüberzustellen, es ist immer beides zugleich. Und über Nacht kann es sich verändert haben, können sich die Mannigfaltigkeiten verwandelt haben, können andere Anschlüsse und Nachbarschaften gefunden sein, nur einen Haltepunkt gibt es nicht. Denn die Distanz zwischen den Singularitäten besteht nicht in einer Trennung, die mir erlaubte, mich etwas, was ich nicht zu sein glaube, gegenüberstellen zu können; sie besteht in Zonen der Nähe (von Linien und ihren Geschwindigkeiten), so daß etwas, das sich in der Zwischen-Zeit ereignet hat, nur in der (unförmigen) Form eines Anders-Werdens zu beschreiben ist. Ein Anders-Werden, das sich nicht getrennt auffassen läßt von einem jetzigen Zustand, in den ich hineingeraten sein mag, sondern zu dem ich mich nicht in Beziehung setzen kann, da ich in diesem Werden mitverwickelt bin. Es handelt sich um eine Drift des Anders-Werdens, das sich nicht in den Maßeinheiten derer abspielt, die durch das Herausgeraten aus dem Werden in den vermeintlichen Zustand des Menschen/des Cogito zurückgelangen. Entscheidend ist das Gewahr-Werden, daß sich über ein Tier oder einen Farbstrich, im Passieren eines Ortes oder einer Stunde eine Bewegung ergibt, der wir nicht nachkommen, die wir nicht zu denken vermögen, zumindest dann nicht, wenn wir sie als Einheit (und folgend in einer Pluralität/Differenz von Einheiten) betrachten wollen (reflektieren, kontemplieren, kommunizieren). Das, was das Undenkbare (Ungedachte) ist, heißt bei Deleuze/Guattari Immanenzebene. Das kann hier weiter nicht ausgebaut werden. Vielleicht wird es an anderer Stelle zu eröffnen sein in einem Satz, der in den letzten Zeilen von ›Was ist Philosophie?‹ steht: »Ein nicht-denkendes Denken«.
[130]Man sollte nicht meinen, das Tier spielen zu können, man solle auch nicht meinen, das Tier ohne weiteres werden zu können. Ist man davon überzeugt, so nimmt man an, daß es sich um eine Richtung handelt, die bestimmbar ist. Doch wie ließe sie sich denn bestimmen? Es ist nicht davon auszugehen, eine Richtung einschlagen zu können, von der man meint, sie ließe sich (wenn schon das Tier nicht) eindeutig angeben. Ein Tier-Werden hat zum einen kein Subjekt, zum anderen hat es kein Objekt, das man wird, zwischen denen es eine Beziehung oder Richtung gäbe. Von dieser Meinung wäre Abstand zu gewinnen (indem man sich klar macht, welche Nähe dieser Abstand voraussetzt). Ich will es folgendermaßen zu formulieren versuchen: um etwa ›klar‹ zu denken, genügt es nicht, oder ist es sogar hinderlich, eine ›klare‹ Richtung einzuschlagen, sondern es gelingt vielmehr gerade darin, indem man in der Weise der Vögel oder Geister herumzuwirbeln beginnt. Ist man versucht, das Leben zu denken, so gelingt dies vielleicht eher über das Werden des ›verendenden Tieres‹.
Es sollte versucht werden, ein Denken zu ermöglichen, das die aufgezeigte Fassung des Tier-Werdens nicht ausschließt, das diesen ›Umweg‹ nicht ausschließt und anzuzweifeln beginnt, daß das, was geschieht, in Termen der Einheit, der Kausalität und der binären und kongruenten Zuteilung zu erfassen wäre. Es ist nicht davon auszugehen, bspw. das Leben, das Tier etc. in einer Denkweise der Vernunft, der sich selbst abschließenden binären Maschine, erfassen zu können (wenn auch sehr wohl zu berücksichtigen ist, wie sehr diese Denkweise am Geschehen beteiligt ist – Erlaubt also die anberaumte Fassung des Denkens, die Sachverhalte zu vernehmen? Deleuze/Guattari zufolge ließe sich das Werden der Ereignisse den Sachverhalten genausowenig gegenüberstellen, wie die Terme, oder wie das Denken und das Gedachte/die Dinge).
Die Möglichkeit besteht vielmehr in einer Anexaktheit, dem Gewahr-Werden dessen, immer schon ›verendendes Tier‹, herumwirbelnder Geist, verharrender Moment zu sein, wenn man einen Gedanken fassen will (der erfasst) – es ist eine Anexaktheit und eine Anstrengung mit allen Kräften, nicht zuletzt wenn es heißt, diese Wahrnehmung des Werdens, die Befreiung des Lebens in einem beständigen Kampf zu versuchen.
Endnoten1 G. Deleuze, F. Guattari: »Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie«, Berlin 1997, S. 399f [wird im folgenden TP abgekürzt], zuvor heißt es dort: »Eine Linie des Werdens wird weder durch Punkte definiert, die sie miteinander verbindet, noch durch Punkte, aus denen sie zusammengesetzt ist. Im Gegenteil, sie geht zwischen den Punkten hindurch, sie stösst nur durch die Mitte und verläuft vertikal zu den Punkten, die man zuvor unterschieden hat, transversal zur lokalisierbaren Beziehung zwischen angrenzenden oder entfernten Punkten. Ein Punkt ist immer ein Ursprungspunkt. Aber eine Linie des Werdens hat weder Anfang noch Ende, weder Ausgangspunkt noch Ziel, weder Ursprung noch Bestimmung. […] Eine Linie des Werdens hat nur eine Mitte. Die Mitte ist kein Mittelwert, sondern eine Beschleunigung, die absolute Geschwindigkeit der Bewegung […]«.
⤴
2 G. Deleuze, F. Guattari: »Was ist Philosophie?«, Frankfurt/M. 1996, S. 340 [wird im folgenden Ph abgekürzt].
⤴
3 Doch auch der Weg hat diese Punkte nicht. »Bei einem Weg, einer Linie zählt immer die Mitte – nicht der Anfang und nicht das Ende. Man befindet sich stets inmitten eines Wegs, mitten in einer Sache«. Das wären gute Voraussetzungen. Vgl. G. Deleuze, Cl. Parnet: Dialoge, Frankfurt/M. 1980, S.35f [wird im folgenden D abgekürzt].
⤴
4 TP, S. 36.
⤴
5 TP, S. 19. Das sind wichtige Eigenschaften des Rhizomatischen, da es sich selbst (und seinem Denken) vielfältige Zugangsmöglichkeiten bietet: da es ein Gefüge aus anschliessbaren Linien, eine sich immerzu fortsetzende Bewegung ist, wird Deleuze/Guattari zufolge verunmöglicht, »einen Dualismus oder eine Dichotomie« ähnlich einem Baumsystem zu konstruieren. Das Rhizom kann weitere Linien aufnehmen, und d.h.: es kann sich auch mit dem Baum und der Wurzel verbinden, oder mit dem dualistischen oder dichotomischen Denken, dieses sowohl einfangend, ihm aber auch immer wieder (kurzzeitig) ausgeliefert.
⤴
6 TP, S. 36.
⤴
7 TP, S. 20, D, S.10, S.14.
⤴
8 TP, S. 325. Nur grob anzugeben ist die Bestimmung der von mir gewählten Bezeichnung einer alterierenden Bewegung: sie bezeichnet die von einer dualitären Alternative, einem Wechsel sich unterscheidende/abhebende vollständige Abänderung.
⤴
9 Vgl. insb. das genannte Kapitel, TP S. 317-422, sowie das Buch zu Kafka; G. Deleuze, F. Guattari: »Kafka. Für eine kleine Literatur«, Frankfurt/M. 1976 [wird im folgenden K abgekürzt]. Es werden in TP nahezu nur Beispiele aus den Bereichen der Kunst von den Autoren gewählt, einige Beispiele stammen zudem auch aus dem Gebiet der Psychoanalyse.
⤴
10 TP, S. 324 [Hervorhebung: A.L.] und S. 373: »Ein tatsächliche Tier-Werden, ohne daß man in Wirklichkeit zum Tier wird.«
⤴
11 TP, S. 327, S. 323.
⤴
12 K, S. 21.
⤴
13 TP, S. 325ff.
⤴
14 TP, S. 325.
⤴
15 K, S.19f., S.49ff. Auf diesen Seiten differenzieren Deleuze/Guattari genauer als hier wiedergegeben, ob, wann oder wie stark es sich bei den Tier-Werden um eine Flucht oder einen Ausweg oder ein Besitznehmen handelt. Doch es bleibt, so sagen sie, ein Hauptthema bei Kafka, und es wäre hier vereinfachend zu wagen, es in einem Komplex zu belassen.
⤴
16 TP, S.354.
⤴
17 TP, S. 377.
⤴
18 TP, S. 41f.
⤴
19 TP, S. 379. Die Formulierung über etwas hinaus ist ein unpassender (gar transzendent anmutender?) Ausdruck, der einzig passend (weniger unzulänglich) erscheinen kann, wenn man ihn liest in einer (Deleuze/Guattarischen) Denkfigur, nach der das Äußerste zugleich das Innerste ist.
⤴
20 Das Nebeneinander von Zwischenraum und Kontiguität ist nicht als ein Oxymoron zusammengestellt oder zu lesen. Ein solches Oxymoron würde kaum anders als metaphorisch zu verstehen sein. Ein von Deleuze/Guattari nicht geschätztes Verfahren, das sich zu sehr in einem dichotomischen Denken begründet. Diesem Verständnis wird entgegnet: dieses Nebeneinander ist durchaus als einer dieser, hier: begrifflichen, Blöcke und Nachbarschaften zu verstehen. (Deleuze/Guattaris Widerwillen an der Metapher wird später kurz aufgenommen.)
⤴
21 TP, S. 400.
⤴
22 TP, S. 325.
⤴
23 TP, S. 371f. Es wären zwei Weisen der Begegnung vorstellbar: »beide Arten von Partikeln geraten in Nachbarschaft zueinander. Man könnte auch sagen: Partikel aussenden, die bestimmte Beziehungen von Ruhe oder Bewegung annehmen, weil sie in eine bestimmte Nachbarschaftszone geraten; oder die in diese Zone geraten, weil sie diese Beziehungen übernehmen«.
⤴
24 TP, S. 372.
⤴
25 TP, S. 374; vgl. zu Deleuze/Guattaris Ablehnung der Metapher: D, S. 11, 25; K, S. 32, 51 und in G. Deleuze: »Unterhandlungen«, Frankfurt/M. 1993, S. 46, 206 [im folgenden U abgekürzt].
⤴
26 TP, S. 389. Hier klingt vielmehr an, daß das Äußerste im Inneren zu liegen kommt. Tier-Werden: Daß das Äußerste des Anders-Werden des Tieres im Innersten der Umklammerung und Nachbarschaft von Mensch und Tier statthat.
⤴
27 Vgl. Ph, S. 204: Zum Werden heißt es dort: »Das ist eine Unbestimmtheits, eine Ununterscheidbarkeitszone, als ob Dinge, Tiere und Personen […] in jedem einzelnen Fall jenen doch im Unendlichen liegenden Punkt erreicht hätten, der unmittelbar ihrer natürlichen Differenzierung vorausgeht«. Ist also doch von Punkten die Rede, von einer vorausgehenden Einheit? Es scheint, daß der Begriff des Werdens in dieser tatsächlichen Unbestimmtheits- oder Ununterscheidbarkeitszone das Vermögen erlangt, sich nicht auf die von Deleuze/Guattari gemiedenen Punkte oder Einheiten reduzieren zu lassen. Zu vermuten wäre m.E. die zum Tier-Mensch-Block (als zuvor unterschiedene Terme) hinzukommende Ununterscheidbarkeit von ursprünglicher Einheit und folgender Differenzierung. Verlassen wird damit genau die Unterschiedenheit von Anfangs- und Endzustand, die einem Denken zeitlicher Abfolge und binärer Verästelungen innewohnt.
⤴
28 D, S. 10.
⤴
29 TP, S. 352. Wenn etwas mit dem einen oder anderen geschieht, dann ein Tier-Werden des Menschen gleichzeitig und unauflöslich mit einem Anders-Werden des Tieres. (Anzugeben wäre, daß in diesem Beispiel, in einer Schrift Vladimir Slepians, das Werden an den Gefahren des Tier-Werdens scheitert – d.h.: die Komposition mißlingt, weil sie sich von den Figurationen des Hundes wie des Menschen nicht lösen kann, oder anders (wenn das ›sich-lösen-von‹ zuviel verlangt sein sollte): weil sie in keinster Weise aus den Figurationen hinauszukommen vermag –; ein Scheitern, das allerdings für die hier an diesem Beispiel besorgten, darüber hinausgehenden Ausführungen unwichtig ist.)
⤴
30 TP, S. 324.
⤴
31 TP, S. 415. Diese Unauflöslichkeit wird, hier nur angerissen, die Komposition in der Kunst bestimmen. Das sind Fragen der Komposition in der Kunst, in der das Tier zu dem werden kann, was Künstler schaffen.
⤴
32 Ph, S. 203.
⤴
33 Vgl. TP, S. 19.
⤴
34 Zit. nach G. Deleuze: »Foucault«, Frankfurt/M. 1997, S. 175.
⤴
35 TP, S. 380.
⤴
36 TP, S. 397.
⤴
37 TP, S. 354ff.; U, S. 205f.
⤴
38 TP, S. 358, S. 360f.
⤴
39 TP, S. 356ff. »…Dieses Tier ist dieser Ort! ›Der magere Hund rennt auf der Straße herum, dieser magere Hund ist die Straße‹ ruft Virginia Woolf. So muß man fühlen« Es ist eine gelungene Form, das Geschehen, das sich ereignende Werden zu verdeutlichen und eine Ahnung davon zu vermitteln, wie das Werden zu denken ist. Hinzugefügt sei, daß es ebenso auch möglich ist, zwei Tageszeiten zu sein: »Wir alle sind fünf Uhr nachmittags oder eine andere Stunde und eher noch zwei Stunden gleichzeitig, […] Mittag-Mitternacht«.
⤴
40 Vgl. dazu den hier in seiner Dichte mitnichten erfassten Text von G. Deleuze: »Die Immanenz: ein Leben…« in: Fr. Balke, J. Vogl: »Gilles Deleuze. Fluchtlinien der Philosophie«, München 1996, S.29-33 [im folgenden IL abgekürzt].
⤴
41 TP, S. 14 (vgl. S. 40f)
⤴
42 Ph, S. 129. [Hervorhebung durch mich; A.L.]
⤴
43 Ph, S. 128.
⤴
44 Vgl. Ph, S. 110: »Das ›Werden‹ gehört nicht zur Geschichte, noch heute bezeichnet die Geschichte lediglich die Gesamtheit der wie immer rezenten Bedingungen, von denen man sich abwendet, um zu werden, das heißt, um etwas Neues zu schaffen«. Das heißt aber auch: Deswegen benötigt das Werden die Geschichte.
⤴
45 Ph, S. 129f. und U, S. 244 (vgl.: Ph, S.182ff).
⤴
46 Ph, S. 122.
⤴
47 U, S. 245; Ph, S.129f. »Man müsse einerseits den Sachverhalt unterscheiden, den wir passieren, wir selbst und unsere Körper, und andererseits das Ereignis, in dem wir versinken oder auftauchen, […]«; Ph, S. 182f. Letzteres ist eine Weise, die aufgrund der auf Auflösung der Komponenten beruhenden Beschaffenheit dem Zellular-, Molekular- und Elementar-Werden, Abschnitten eines jeden Werdens, gleicht. (Vgl. TP, S. 339 und 371, wo diese aufgelistete Reihenfolge dargelegt wird, die sich schliesslich in ein Unwahrnehmbar-Werden verwandelt. Ein Unwahrnehmbar-Werden, das dem zur Farbe gewordenen Vogel gleicht, als Beispiel eines in der Malerei erfassten Ereignisses, eines Intensiv-Werdens in der oder durch die Farbe.)
⤴
48 Ph, S. 129f. Es ist ein Anders-Werden des Philosophen, so die Autoren. Doch ist es nicht auch ein Künstler-Werden des Philosophen und ebenso ein Anders-Werden des Künstlers? An anderer Stelle werden zwei Arten des Werdens angesprochen, eines betrifft das Künstlerische, das zweite das Begriffliche. Es ist das sinnliche (künstlerische) Werden, das jenen Akt meint, »durch den etwas oder jemand fortwährend anders-wird (und dabei bleibt was er ist)«, und damit in der Unterscheidung steht zum begrifflichen (philosophischen) Werden, das den Akt (gegenüber einer Geschichte) meint, wenn das »gemeinsame Ereignis«, als das ›etwas oder jemand‹ betreffende, begriffen oder erfasst ist, und jedoch den Begrifflichkeiten der ›zuvor unterschiedenen‹ Termen »ausweicht« (vgl. Ph, S. 209f.)
⤴
49 Ph, S. 129f.
⤴
50 K, S. 12 (Wenn es auch hier in Bezug auf Kafkas Werk geschrieben wurde und einige Vokabeln einführt, die hier nicht weiter auftauchen, es ist letztlich übergeleitet zu dem, was zumindest das Werk und Schaffen Bacons betrifft.)
⤴
51 Vgl. TP, Kapitel 8, S. 263-282. Die Frage »Was ist passiert? Was kann denn nur passiert sein?« durchzieht dieses 8. Kapitel, es ist eine Frage, mit der – so verbinden es Deleuze/Guattari mit der Novelle – versucht wird, ein einschneidendes Ereignis zu erfassen, um einer vollständigen Verwandlung gewahr zu werden, um zu diagnostizieren, wie »es jetzt so gekommen ist« (ggf. in einem Erleben, das zugleich aber vom Bereich der Ereignisse in den der geschichtlichen Sachverhalte zurückfällt). Der Bezug zum Werden oder den hier gemachten Ausführungen ist nicht besonders evident, und doch besteht eine Verbindung darin, die Prozesse des Werdens aufzulösen, oder vielmehr: sich auflösend in ihnen einzunisten (Linien, Diesheiten etc.). Doch ist das Abschließen mit der zitierten Frage in anderer Hinsicht problematischer, geht es doch beim Erfassen des Ereignisses um die Komponenten, Linien und Prozesse eines Werdens, die außerhalb einer Geschichte liegen, da das Ereignis »Zwischen-Zeit« ist. Ein Augenblick, in dem nichts geschieht (»ein unendliches Warten, das bereits unendlich vergangen ist«), alles aber wird, da das Ereignis Werden ist. So sollte also eine Frage nach dem, was passiert, auf wenig vom Werden oder vom Ereignis stossen, wenn sie nicht, und so wollen wir es hier fassen, darauf zielt, das Passierende zu erfassen, das sich Ereignende in einem Werden. »Nichts geschieht, und doch ändert sich alles«, das ist ein singuläres Ereignis, eine eingeschlagene Richtung des Werdensblockes, das markiert: es ändert sich mehr als daß ein Mensch zu einem Tier wird. (Vgl. dazu im Kapitel über die Wissenschaft, Ph, S 183ff.)
⤴
52 Ph, S. 204f.
⤴
53 Nahezu ausschließlich für die Kunst bestimmen Deleuze/Guattari dieses Vermögen, diesen Bereich zugänglich zu machen. Im Buch ›Was ist Philosophie‹ wird das Werden zumeist im 7. Kapitel, das die Kunst thematisiert, ausgearbeitet. Es sind nicht ausschließlich Formen des Tier-Werdens, doch finden sich überall in der (modernen) Kunst Werdensprozesse, Gefüge und Mannigfaltigkeiten, Geschwindigkeiten und Nachbarschaften, Komponenten, die sich nicht in einer Dualität und Abfolge erfassen lassen.
⤴
54 Vgl. zur Kontrapunktik, die von Deleuze/Guattari nicht explizit mit Wespe und Orchidee und deren De-, Re- und Territorialisierungen zusammengebracht wird, Ph, S. 220ff.
⤴
55 Ph, S. 212.
⤴
56 zit.: Ph, S. 191, 196, 204, 234.
⤴
57 Ph, S. 204.
⤴
58 FB, S. 28; IL, S. 29.
⤴
59 Ph, S. 192. Die Kunst wird als Sprache der Empfindungen aufgefasst: so wie der Mensch in Wörtern, Farben, Tönen, Steinen gefasst ist, ist er Empfindung. Die Kunst läßt das Material in Empfindung übergehen (vielmehr, als daß sie die Empfindung in Material verwandelt, was ähnlich dem Vorgehen wäre, das Ereignis in Sachverhalte zu übertragen und es so zu verfehlen). (Vgl. Ph, S. 208, 229f.)
⤴
60 Ph, S. 229; 216f.
⤴
61 G. Deleuze: »Francis Bacon – Logik der Sensation«, München 1995, S. 39f [wird im folgenden FB abgekürzt]. Dazu auch in Ph, S.215f. (Gemalt wird, was einer Kraft ausgesetzt ist, in dem Augenblick zwischen zwei Geschichten oder Sachverhalten, S. 98). Dieses Buch ist durchaus als Philosophiebuch zu verstehen, in der Deleuze ebenso seine Philosophie in das Werk Bacons hineinträgt, wie er auch das Baconsche Denken aufgreift und in seine Überlegungen einfließen läßt; vgl. U, S.199ff.
⤴
62 Im folgenden werde ich (wie im vorhergehenden Teil auch schon angeklungen), in etwa der Handhabung Deleuzes bzw. Deleuze/Guattaris entsprechend/entstammend, die Überlegungen sowohl auf Francis Bacon beziehen, als auch auf solche quasi verallgemeinernden Begriffe wie: der/die Künstler, die Malerei (womit meist die moderne Kunst gemeint ist) etc. Dabei wird nicht klar zwischen beidem getrennt, beides steht füreinander da.
⤴
63 FB, S. 55. Anzumerken wäre, daß sich also auch in der Malerei Bacons nur schwer ein Anfang(szustand) bestimmen läßt. Ist auch er in einem rhizomatischen Gefüge, das ihn in der Mitte beginnen und ihn obendrein zugleich noch etwas anderes werden läßt?
⤴
64 FB, S. 55.
⤴
65 FB, S. 60.
⤴
66 FB, S. 59. Im Buch (FB) wird, ausgehend von Lyotard, der Begriff »figural« von Deleuze verwendet, der sich vom Begriff des »figurativen« unterscheidet. Die Figur bei Bacon wird von Deleuze in dieser ersteren, figuralen Hinsicht verstanden. Ich werde, diesen Umstand berücksichtigend, im weiteren dennoch von der Figur sprechen, die einzig durch das Brechen mit der Figuration entstehen kann.
⤴
67 Sich von der Figuration, von der Illustration und von einer Narration zu befreien und loszumachen, darin besteht, so Deleuze, die Arbeit des (modernen) Künstlers; vgl. dazu v.a.: FB, S. 9ff, 13f, 27f, 45, 55ff, passim. Der Kampf gegen die Klischees ist im Falle der Künstler sogar bedeutender als der gegen das Chaos; vgl. dazu: Ph, S. 241.
⤴
68 FB, S. 63.
⤴
69 FB, S. 62.
⤴
70 FB, S. 96.
⤴
71 FB, S. 62f. Vgl. dazu Deleuze/Guattaris Bestimmung der »Möglichkeit als ästhetische Kategorie«, einer Kunst die mögliche Welten erschaffen oder erfinden kann; »der Künstler fügt der Welt stets neue Spielarten hinzu«, durch neue Empfindungswesen, die Deleuze/Guattari Varietäten nennen (Ph, S. 207, 210).
⤴
72 FB, S. 9.
⤴
73 FB, S. 97.
⤴
74 FB, S. 10f.
⤴
75 FB, S. 15.
⤴
76 FB, S. 16.
⤴
77 FB, S. 16f.
⤴
78 In einer Passage des Kunst-Kapitels in ›Was ist Philosophie?‹ machen Deleuze/Guattari eine Ausführung zu drei Elementen der Malerei, die sie mit Leib, Haus und Welt/Kosmos benennen. Beide Dreiteilungen gehen nicht ineinander auf, doch lassen sich einige entsprechende Merkmale herausstellen: Ausgehend vom Leib und der Frage, ob dieser in der Lage ist »Perzept und Affekt zu tragen«, gelangen sie zur Feststellung, daß der Leib »vielmehr […] getragen und in andere Lebensmächte übergehen« muß. Das Fleisch bei Bacon, das empfindet, kommt diesem ersten Element sehr nahe, es markiert zudem die Ununterscheidbarkeit von Mensch und Tier, doch es »rutscht« abwärts, kann sich nicht halten. Gestützt wird es durch das zweite Element, das Haus, in dem als Körper die Knochen, im Bild aber vor allem die Farbflächen als Gerüst hinzutreten, die Wände des Hauses bilden, dem Leib einen Rahmen geben (Figur und materielle Struktur). Hinzu kommt jedoch das dritte Element, dem auf den ersten Vergleich nichts zu entsprechen scheint: »die Welt, der Kosmos«. Zu diesen steht das Haus in Verbindung, es kann Fenster öffnen, so daß »der Leib oder vielmehr die Figur« »nicht mehr den Schauplatz, das Haus, sondern ein Universum« bewohnt, das das Haus stützt. »Es ist gleichsam der Übergang vom Endlichen zum Unendlichen«, eine Operation der Kunst, die Endliches erschafft und komponiert, um in einer Entrahmung das Unendliche zurückzugeben. Vgl. Ph, S. 210ff, zu Fleisch und Knochen auch: FB, S. 19ff, zur Entrahmung und dem Unendlichen: Ph, S. 222ff, 235ff.
⤴
79 FB, S. 31.
⤴
80 FB, S. 53, 41.
⤴
81 FB, S. 40f.
⤴
82 FB, S. 43 (vgl. S. 92).
⤴
83 Die Sensation ist durchaus eher im Sinne der Empfindung als im Sinne des ›Sensationellen‹ zu verstehen. Die Sensation ist das Gegenteil des ›Sensationellen‹, aber auch des Klischees. Merleau-Ponty folgend, sieht Deleuze »›das Empfinden‹« als ein Feld konstituierend, »das für sich gültig ist und mit anderen interferiert (›pathisches‹ Moment)«, gegenüber der anderen Weise, die »sich auf ein identifizierbares Objekt bezieht (figuratives Moment)« Vgl. FB, S. 27, Fußnote 1.
⤴
84 FB, S. 39.
⤴
85 FB, S. 31.
⤴
86 FB, S. 27ff. Die Formulierung ist ungenau: der Körper ist Empfindung nur in seiner Auflösung und Ununterscheidbarkeit zur Farbe etc.
⤴
87 FB, S. 34. »Im Zusammentreffen der Welle auf einer bestimmten Ebene mit äußeren Kräften«, die auf den Körper einwirken, »erscheint eine Sensation« als eine Schwingung, die »intensive Realität« besitzt. Diese Realität der Empfindung und der Augenblick der Ununterscheidbarkeit im Werden bewirken, daß die provisorischen Organe nur für eine Sensation bestehen, daß das Werden nur im Gefüge einer Diesheit existieren kann; FB, S. 32f. Es ist eine »Beharrlichkeit« und Gegenwärtigkeit, die die Figuren Bacons im Zustand ihrer athletischen Anstrengung zeigt; FB, S. 35; Ph, S. 239.
⤴
88 FB, S. 18.
⤴
89 FB, S. 19ff. Es ist nicht der Schrecken (das ›Sensationelle‹), den Bacon malen möchte, sondern der Schrei (vgl. FB, S. 41). »Und der Schrei, Bacons Schrei, ist die Prozedur, mit der der Körper insgesamt durch den Mund entweicht.» (FB, S. 17).
⤴
90 FB, S. 19f.
⤴
91 FB, S. 19f. »Der ganze Körper wird von einer Bewegung durchlaufen. Einer unförmig unförmigen Bewegung, die in jedem Augenblick das reale Bild auf den Körper überträgt, um die Figur zu bilden«; FB, S. 18.
⤴
92 Bezogen auf die Beschreibung des Rhizomatischen wäre es die Dimension, die den Punkten nicht eine Einheit stiftet, sondern die in der Mannigfaltigkeit aufgeht (ebenso wie die Linien, in die sie die Punkte auflöst), eine Dimension, die jedoch ähnlich einer Karte die abändernde Bewegung des Rhizoms aufzeichnet (im Bild ist es die Kontur); vgl. zur Karte des Rhizoms TP, S. 23ff.
⤴
93 Vgl. dazu in etwas anderer (oder verschiedener) Hinsicht, verdeutlicht für das Geheimnis: Ph, S. 393f.
⤴
94 FB, S.19; TP, S. 415: Deleuze/Guattari sprechen von diesem Vogel, »der ebensoviel Werden hat wie das, was mit ihm wird«, und erweitern das Werden dahingehend, daß es in der Kunst eine Imitation zerstören kann, da bspw. die Farbe ihrerseits in das Werden, in den Block einbezogen ist, wenn sie den Vogel bildet und werden läßt, dabei aber selbst Vogel wird und ihn nicht mehr abbilden kann, da der Vogel nicht etwas (von der Farbe) Getrenntes ist, das einer Übertragung vorausgesetzt wäre.
⤴
95 Es ist schwierig zu sagen, »wo die Empfindung tatsächlich beginnt und wo sie aufhört; natürlich gehören […] die Spur des Pinselhaars und vieles andere mehr zur Empfindung«; s. Ph, S. 194 [Hervorhebung von mir; A.L.]. Im Bild gibt es eine Auflösung in die Empfindung, wenn der Pinselstrich, der in Farbe übergehende Vogel und das Intensiv-Werden des Menschen in den Farben die Sensation sind (genauso wie es eine Auflösung des Menschen, des Tieres in Diesheiten ist).
⤴
96 Ph, S. 215.
⤴
97 FB, S. 23ff. Das ist spätestens der Moment, in dem sich die Figur in der Farbfläche aufzulösen beginnt; für eine kleine und späte Serie von Landschaftsbildern zeigt es Deleuze: die Figur wird »nur noch Sand, Gras, Staub oder Wassertropfen sein«, in diesen Bildern ist das eine der drei Grundelemente, die Figur, nicht mehr auszumachen.
⤴
98 Vgl. FB, S. 66, S. 83ff. Um das Ereignis zu fassen, hat der Künstler die Aufgabe, die Empfindungen in Blöcken zu komponieren. »Nicht nur in seinen Werken erschafft er sie, er gibt sie uns und läßt uns mit ihnen werden, er nimmt uns mit hinein ins Zusammengesetzte«. Das Ereignis ist zu fassen, wenn es (im Werk) durchlaufen werden kann; Ph, S. 207.
⤴
99 Ph, S. 198f.
⤴
100 FB, S. 27. [Hervorhebung von mir; A.L.]
⤴
101 FB, S. 31.
⤴
102 Ph, S. 198f.
⤴
103 TP, S. 383f.
⤴
104 Ph, S. 198f.
⤴
105 FB, S. 20.
⤴
106 Ph, S. 127. Zuvor heißt es dort: »Man denkt und schreibt für die Tiere selbst«, und dazu sagen Deleuze/Guattari: »Freilich, was bedeutet ›für‹? Nicht ›zugunsten von…‹, nicht einmal ›an Stelle von…‹. Es bedeutet ›vor‹. Es ist eine Frage des Werdens« und eine Frage dieses Verfängnisses mit dem Tier. Man muß etwas anderes werden, um es anders-werden zu lassen. Keine Rechnung in einem binären Code der Einheiten, vielleicht kann es als ein Denken verstanden werden, das in etwas weiteres eingreift.
⤴
107 Ph, S. 231.
⤴
108 FB, S. 61 (vgl. S. 96).
⤴
109 FB, S. 12 (Deleuze zitiert hier André Bazin, der dieses über Jacques Tati schreibt).
⤴
110 Ph, S. 205; TP, S. 35.
⤴
111 Vgl. dazu: G. Agamben: »Bartleby oder die Kontingenz gefolgt von Die absolute Immanenz«, Berlin 1998, S.113ff.
⤴
112 FB, S. 19f.
⤴
113 Ph, S. 126f [aus dem Zusammenhang gerissen von mir; A.L.]
⤴
114 Ph, S. 86; im Zusammenhang heißt es dort: »Jedes Denken ist ein ›Fiat‹, macht einen Würfelwurf […]. Allerdings ist das ein sehr kompliziertes Spiel, denn das Werfen besteht aus unendlichen Bewegungen, die reversibel und ineinandergefaltet sind […].«
⤴
115 Ph, S. 60.
⤴
116 Insofern ist das Denken selbst Bewegung. Man denkt die Bewegung »vermittels einer Begriffsperson«, wie es dort weiter heißt; Ph, S. 73. Die Begriffsperson der Philosophie unterscheidet sich zwar in gewisser Hinsicht von den ästhetischen Figuren der Kunst, doch gerade mit ihnen verschwimmen diese Bereiche.
⤴
117 Ph, S. 73 (vgl. S. 251).
⤴
118 TP, S. 397.
⤴
119 Vgl. FB, S. 29.
⤴
120 Ph, S. 64. In diesem Sinne wäre ein Denken gemeint, das »vielmehr einer Gewalt entspringt, die dem Denken angetan wird« (Cl. Parnet); vgl. D, S. 31.
⤴
121 [121] Ph, S. 62. Ununterscheidbar, unwahrnehmbar und unpersönlich, das sind nach Deleuze/Guattari die »drei Tugenden« des Aufgehens in der Welt, die für jedes Anders-Denken stehen; vgl. TP, S.381f.
⤴
122 Ph, S. 45. Vgl. Ph, S. 97, dort heißt es: »Subjekt und Objekt sind schlechte Annäherungen an das Denken. Denken ist kein gespanntes Seil zwischen einem Subjekt und einem Objekt noch eine Revolution, ein Umlauf des einen um das andere. Denken geschieht vielmehr in der Beziehung zu dem Territorium und zu Terra, der Erde«, mit der Deleuze/Guattari die Passagen der Geophilosophie einleiten.
⤴
123 Ph, S. 50.
⤴
124 Ph, S. 50. Das gleichzeitige Werden bestimmt sich: es ist »keine Bewegung von einer zur anderen [Bestimmung; A.L.], sondern im Gegenteil die Unmöglichkeit eines Bezugs zwischen zwei Bestimmungen, da die eine nur dann erscheint, wenn die andere bereits verschwunden ist, und die eine im Verblassen erscheint, wenn die andere als Umriß verschwindet.« Es ist kein maßgeblicher Haltepunkt im Spiel, der die Bestimmungen in Beziehung setzt, weil er sie unterscheiden könnte. Es ist ein Hinüberfließen, das weder Anfang noch Ende in den Bestimmungen findet, sondern eine eigene Richtung hat, entlang der das Tier-, Pflanze- oder Molekül-Werden das Denken bewegt hat.
⤴
125 Ph, S. 64.
⤴
126 Ph, S. 64.
⤴
127 Ph, S. 125.
⤴
128 TP, S. 12.
⤴
129 …wie zuvor – so könnte man anfügen, doch besteht das Zuvor nicht mehr; es gibt kein Zuvor und kein Zurück.
⤴
130 Ph, S. 260.
⤴